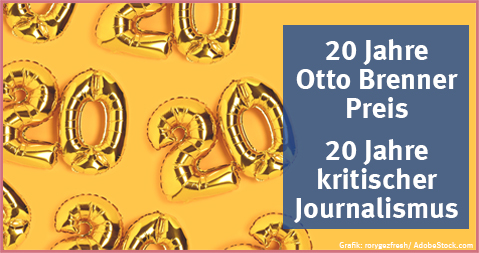3. Preis - Jens Sitarek, Harald Zigan und Timo Büchner
Ein unheimliches „Jugendheim“ Rechtsextremisten auf dem Dorf – über Jahre beobachtet von drei couragierten Journalisten
In jahrelanger Arbeit deckten drei Lokaljournalisten rechtsextreme Umtriebe auf – und das unter schwierigsten Bedingungen. Der Otto Brenner Preis würdigt eine Recherche über ein altes Bauernhaus in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg.
Von Charlotte Theis
Erster Akt: Hohenlohe – Das Land der Burgen, Felder und Neonazis
Gibt man ‚Hohenlohe‘ in die Suchmaschine ein, erscheinen idyllisch anmutende Bilder von Fachwerkhäusern, Burgen, Schlössern, Weinbergen und gelb leuchtenden Feldern. Die Region im Nordosten von Baden-Württemberg wirkt wie eine freundliche, urige Märchenwelt. Hier ist der Sitz des Hohenloher Tagblatt. Die lokale Tageszeitung hat eine gedruckte Auflage von rund 10.000 Exemplaren und besteht aus einer siebenköpfigen festen Redaktion, sowie circa 20 freien Mitarbeiter*innen. Drei der Lokaljournalist*innen – Timo Büchner, Jens Sitarek und Harald Zigan – wurden 2024 für ihre Artikelserie rund um das „Jugendheim Hohenlohe“ mit dem Otto Brenner Preis ausgezeichnet. Denn die Journalisten haben hinter die Fassade der Hohenloher Märchenlandschaft geschaut und sind dabei über Jahre hinweg tief eingetaucht in eine Welt, die gegensätzlicher kaum sein könnte: Das sogenannte „Jugendheim“, ein altes Bauernhaus im Dorf Herboldshausen, ist ein Treffpunkt der extremen Rechten in Süddeutschland. Das Haus ist seit 50 Jahren im Besitz des völkischen ‚Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) e. V.‘, der Teil des extrem rechten und antisemitischen ‚Ludendorff-Netzwerk‘ ist. Mittlerweile wird er, auch dank der Veröffentlichungen im Hohenloher Tagblatt, vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer wieder finden in dem Bauernhaus Neonazi-Treffen statt: Man will mit dieser Ortswahl wohl unter dem Radar bleiben, um sich zu vernetzen und die lokale Jugend zu indoktrinieren.
Doch diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Wenn man „Jugendheim Hohenlohe“ in die Suchmaschine eingibt, ergibt sich dank Zigan, Büchner und Sitarek ein anderes Bild: Es erscheinen Fotos von Menschen in Tracht, die Männer tragen Lederhosen, die Frauen haben ihre Haare zu Zöpfen gebunden; auf einem der Fotos stehen sie im Dunkeln zusammen und strecken Fackeln in die Höhe – die Szene wirkt bedrohlich.
Zweiter Akt: Der Wasserturm in Herboldshausen oder wie es so richtig losging
Jahrelang blieb der völkische Bund der sogenannten ‚Ludendorffer‘, benannt nach der völkischen Ideologin Mathilde Ludendorff, in seinem „Jugendheim” eher unter sich. „Ab und zu sind sie mal mit Volkstänzen auf der Straße aufgefallen“, erinnert sich Zigan. Doch 2020 sollte sich das ändern. Zigan und Sitarek berichteten zu dieser Zeit schon gemeinsam für das Hohenloher Tagblatt über die ‚Querdenker‘-Bewegung in der Region. Bis heute finden im nahe gelegenen Crailsheim „Montagsdemonstrationen“ statt. Es kam zum Austausch der Verschwörungsanhänger*innen und zu Vernetzungen mit der rechten Szene.
„Je mehr man sich damit beschäftigt, desto eher erkennt man die Netzwerke.“ – Jens Sitarek
Zur gleichen Zeit gab es in Sachen „Jugendheim“ in Herboldshausen einen Wendepunkt in der Recherche. Die Jugendorganisation ‚Junge Nationalisten‘ der ehemaligen NPD (heute ‚Die Heimat‘) veranstaltete den ‚Gemeinschaftstag Süd‘ und postete in den Sozialen Medien mehrere Fotos von der Veranstaltung. Auf einem der Fotos war ein Wasserturm im Hintergrund zu sehen, der den drei Journalisten ins Auge stach. Es war der Wasserturm aus Herboldshausen. Das Herboldshausen, in dem es außer ein paar Bauernhöfen und viel Idylle nichts gibt – bis auf besagtes „Jugendheim Hohenlohe” des ‚Bund für Gotterkenntnis e. V.‘ „Das war der erste Beleg, dass sich offen radikalere Neonazigruppen vor Ort befinden. Seitdem hatten wir das Haus und die Umtriebe dort noch stärker auf dem Radar“, erinnert sich Büchner. Der ‚Gemeinschaftstag Süd‘ war der Beginn der Zusammenarbeit im Dreierteam Büchner, Sitarek und Zigan. In Herboldshausen folgten Treffen der ‚Identitären Bewegung‘ und der sogenannte ‚Thing der Titanen‘ – ein Vernetzungstreffen, bei dem die bekanntesten Gesichter der deutschen Neonazi-Szene zusammenkommen. „Mittlerweile schreiben wir nicht mehr über jedes kleine Treffen, das stattfindet, sondern filtern mithilfe unserer Vorinformationen die Veranstaltungen und Personen heraus, die es unserer Meinung nach wert sind, erwähnt zu werden“, erklärt Sitarek. Die Recherche der Journalisten macht in 50 veröffentlichten Artikeln deutlich: Das sogenannte „Jugendheim” ist eine der ersten Anlaufstellen für Neonazis, die Veranstaltungen im Südwesten des Landes durchführen wollen.
Dritter Akt: Recherche unter erschwerten Umständen
Die Dokumentation der Vorgänge im „Jugendheim” ist komplex – das machen die Erzählungen der drei Lokaljournalisten deutlich. Die Berichterstattung gebe es in dieser Form und diesem Umfang nur, weil sie als Team zusammengearbeitet hätten und sich aufeinander verlassen könnten, weiß Sitarek: „Alleine könnte man das gar nicht leisten.“ Denn hinter den Veröffentlichungen im Hohenloher Tagblatt stecke mehr, als zunächst beim Lesen der Texte ersichtlich sei. Das Credo laute immer: Sammeln! Sammeln! Sammeln! Denn man wisse nie, welche Information zu welchem Zeitpunkt noch einmal wichtig werden könne. Immer wieder betonen die Lokaljournalisten den Stellenwert der Grundlagenarbeit: die Auseinandersetzung mit der rechtsextremen Szene durch Fachliteratur und den Austausch mit Kolleg*innen und Expert*innen. „Je mehr man sich damit beschäftigt, desto eher erkennt man die Netzwerke. Die kennen sich untereinander, treten bei ihren Veranstaltungen aber immer in unterschiedlichen Konstellationen auf“, sagt Sitarek.
Deswegen haben sich alle drei Reporter intensiv mit dem antisemitischen und rechtsextremen Milieu auseinandergesetzt – oft auch in der Freizeit, zu später Stunde zu Hause. Es sei Teil seines Alltags, abends die Sozialen Medien nach neuen Erkenntnissen zu durchforsten, so Büchner. Ein nicht zu unterschätzender Teil der Recherche findet in den sozialen Netzwerken statt. Büchner verfolgt aktiv die Telegram-Nachrichten von Neonazigruppen, er kennt die einschlägigen Kanäle und hat sie immer im Blick. Doch die Rechtsextremen sind vorsichtig geworden. Zum Beispiel wird über die Treffen mittlerweile erst im Nachgang gepostet. Das mache es den Journalisten schwer, die Veranstaltungsorte und -zeiten vorab herauszufinden, sagt Büchner. Doch trotz der Hürden weiß der freie Journalist, was er tut: „Normalerweise kann ich mir Namen nicht so gut merken, aber wenn es um Neonazistrukturen geht, weiß ich Bescheid. Das ist halt einfach ein jahrelanges Training“, sagt er.
„Wir wissen einfach, dass die rechtsextreme Szene gewaltbereit ist“ – Timo Büchner
Zehn Minuten sind es mit dem Auto von der Redaktion in Crailsheim bis zu dem „Jugendheim” in Herboldshausen. Die drei sind regelmäßig vor Ort, können zum Schutz ihrer Recherchevorgänge jedoch keine Details über ihre Vorgehensweise verraten. „Mit gemütlich Vorbeispazieren ist da nichts!“, sagt Zigan und Büchner stimmt ihm zu: „Wir wissen einfach, dass die rechtsextreme Szene gewaltbereit ist.“ Deswegen würden sie immer darauf achten, welche Autos vor Ort sind und mit welchen Personen sie rechnen müssen. „Aber es ist und bleibt eine Gratwanderung“, beschreibt Büchner die Situation. Sein Kollege Sitarek ergänzt trocken: „Man darf sich einfach nicht erwischen lassen.“ Ihr Ziel sei es, den Menschen in Hohenlohe möglichst nahe zu bringen, was dort vor sich gehe. „Ich fände es fatal, wenn jemand Überregionales über das Jugendheim schreiben würde und einfach ein Agenturfoto abdrucken würde, ohne es einmal live gesehen zu haben. Denn dieses Gefühl, das man vor Ort hat, das kann man so nicht transportieren“, so Sitarek.
Sicherheitsbedenken gehören für die drei zum Alltag dazu, denn die extreme Rechte ist bekannt dafür, Journalist*innen einzuschüchtern und anzugreifen. Regelmäßig gebe es auch gegen sie Anfeindungen in den Sozialen Medien. Büchner berichtet von dem bisher für ihn bedrohlichsten Vorfall, bei dem eine Neonazi-Gruppe einen Zollbeamten kontaktierte und ihn bat, mithilfe seines Dienstcomputers Büchners im Melderegister gesperrte Privatadresse abzufragen. „Das ist nur zufällig aufgefallen, weil es eine Razzia gab und die entsprechenden Chats gefunden wurden. In diesen Chats wurde auch überlegt, wie man mich einschüchtern kann“, erzählt der freie Journalist. Und auch in Herboldshausen selbst kam es im Juli 2023 zu einem Übergriff: Ein Mann, der mit dem Auto an dem „Jugendheim” vorbeifuhr, wurde von einer Gruppe junger Erwachsener, die aus dem Haus gestürmt kamen, angegriffen. „Die haben auf der Motorhaube rumgetrommelt und versucht, die Tür zu öffnen. Der Mann ist dann im Rückwärtsgang zurückgefahren und hat das Ganze sogar noch gefilmt“, erinnert sich Sitarek. Mittlerweile gab es eine Strafanzeige, aber letzten Endes mussten die Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige eingestellt werden.
Vierter Akt: Eine Welle an unterschiedlichen Reaktionen
Diese Vorfälle zeigen: Die Berichterstattung geht nicht spurlos an den Rechtsextremen vorbei, ganz offensichtlich ist sie ihnen ein Dorn im Auge. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Gegenstrategien gefunden werden, um den Journalisten ihre Arbeit so schwer wie möglich zu machen. So werden bei Veranstaltungen mittlerweile Bauzäune mit Sichtschutzplanen aufgestellt und Autokennzeichen abgenommen oder vertauscht, um die Identifikation der teilnehmenden Personen zu erschweren. Auf seiner Website veröffentlichte der ‚Bund für Gotterkenntnis‘ mehrere Stellungnahmen zu den von Sitarek, Büchner und Zigan veröffentlichten Artikeln. In diesen rückt man sich in abwegigen Vergleichen mit der Unterdrückung Andersdenkender zur Zeit des Nationalsozialismus in eine Opferrolle und erzählt eine Verschwörungsgeschichte, in der die Lokaljournalisten als „Handlanger der Mächtigen“ agieren, um gegen den Verein zu hetzen, ihn zu verfolgen und einzuschüchtern.
„Im Lokaljournalismus ist man ohnehin Überzeugungstäter“ – Harald Zigan
Im Lokaljournalismus sei man es gewöhnt, dass die Veröffentlichungen nicht immer allen gefielen. Aber in seiner fast 30-jährigen Laufbahn sei ihm noch nie etwas so entgegengeschlagen, resümiert Sitarek.
Doch es gab auch etliche positive Reaktionen. Mit ihrer Berichterstattung haben die drei Journalisten die ganze Kommune wachgerüttelt. Zigan, der als erster im Jahre 1985 wegen einer Bauvoranfrage auf die fragwürdigen Besitzer des Bauernhauses stieß, ist stolz auf die Entwicklung: „Als ich damals angefangen habe zu berichten, hat es – auf gut Deutsch – kein Schwein interessiert. Oft kam aus der Bevölkerung: "Was wollt ihr denn von denen? Das sind doch ganz harmlose Leute. Die machen doch nur Volkstänze und tragen Tracht." So habe ich es als meine Aufgabe gesehen, darüber aufzuklären, welches völkische Weltbild sich dahinter verbirgt. Denn das ist alles andere als harmlos. Die öffentliche Wahrnehmung hat sich durch unsere Berichterstattung grundlegend geändert.“ Und tatsächlich: Die kontinuierliche Berichterstattung im Hohenloher Tagblatt hat für Aufklärung in der Zivilgesellschaft gesorgt. Diese wehrt sich nun gegen die unliebsamen Nachbar*innen, unter anderem mit dem ‚Kirchberger Bündnis‘, das regelmäßig Kundgebungen, Mahnwachen und Informationsveranstaltungen organisiert.
Fünfter Akt: Happy End? Die Würdigung durch den Otto Brenner Preis
Die Artikel zum „Jugendheim” in Hohenlohe wurden unter anderem deswegen mit dem Otto Brenner Preis gewürdigt, weil die Arbeitsbedingungen im Lokaljournalismus besonders herausfordernd sind. Die Jury betont, dass die Recherche, die Beobachtungen vor Ort „mit Hintergrundwissen über die Strukturen und die Ideologie der Betreiber verbindet“. Sitarek ist der Überzeugung, dass das ohne das Engagement und die Flexibilität seiner beiden Kollegen, von denen einer frei arbeitet und der andere offiziell im Ruhestand ist, nicht möglich gewesen wäre. „Die beiden konnten außerhalb der tagesaktuellen Zwänge einer lokal-journalistischen Redaktion arbeiten und mir den Rücken stärken“, sagt er. Auch habe ein großer Teil der Arbeit in ihrer Freizeit stattgefunden. Zigan bestätigt dies: „Im Lokaljournalismus ist man ohnehin Überzeugungstäter.“ Dafür sei es einfacher, Veränderungen zu bewirken, glaubt Büchner. „Die Wirkmächtigkeit scheint mir im Lokalen größer zu sein, das haben wir ja bei uns gesehen“, so der freie Journalist. Dafür nehmen die engagierten Journalisten die lebensverändernden Arbeitsbedingungen und Risiken in Kauf. Seine Großmutter habe immer gesagt: „Wer sich einsetzt, setzt sich aus“, und das sei ihm von Beginn an klar gewesen, ergänzt Zigan.
Dass dieser Einsatz jetzt mit dem Otto Brenner Preis ausgezeichnet wurde, bedeutet den drei „Überzeugungstätern“ mehr als nur die Bestätigung der eigenen Arbeit: „Ich bin davon überzeugt, dass es auch gut für unsere Absicherung war. Es ist mein Gefühl, dass wenn doch was passieren würde, die Welle jetzt viel größer wäre, es hätte eine ganz andere Wucht“, sagt Sitarek. Die anderen beiden stimmen zu. Und auch bei der Frage, wie es mit der Recherche weitergehe, sind sie sich einig: „Es sind noch nicht alle Geschichten erzählt.“ Und so geht die Geschichte der ‚Ludendorffer‘ in Hohenlohe wohl weiter.
Infokasten: Das „Jugendheim” und seine Besitzer
Das sogenannte „Jugendheim Hohenlohe” liegt in Herboldshausen, einem Dorf unmittelbar an der A6 im Nordosten von Baden-Württemberg. Die Besitzer*innen betitelten das große, alte Bauernhaus mit dem mittlerweile etablierten Begriff „Jugendheim Hohenlohe”, welcher angesichts eines Domizils für Rechtsextreme jedoch eher als Euphemismus zu verstehen ist. Es ist die einzige öffentlich bekannte Immobilie in Baden-Württemberg, die in den Händen der extremen Rechten liegt. 1972 wurde das Haus von einem Mitglied der ‚Ludendorffer‘ gekauft und ist seitdem im Besitz des rechtsextremen Vereins. Der unter anderem durch den ‚Hitler-Ludendorff-Putsch‘ bekannte General Erich Ludendorff und seine Frau, Mathilde Ludendorff, die Ärztin und Autorin völkischer Schriften war, sind die Namensgeber für das ‚Ludendorff-Netzwerk‘. Das völkische Netzwerk gründet auf der rassistischen und antisemitischen Ideologie von Mathilde Ludendorff. Die ‚Ludendorff-Bewegung‘ galt als eine der bekanntesten völkischen Gruppierungen der Weimarer Republik und ist seither Teil der extremen Rechten in Deutschland. Das Netzwerk besteht aus vielen Vereinen, Unternehmen und Untergruppierungen. Die wichtigste Organisation des Netzwerkes ist der ‚Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) e. V.‘.
Laut baden-württembergischem Innenministerium vertritt der Verein eine strikte „Rassentrennung“ sowie „fremdenfeindliche, antisemitische und revisionistische Positionen“. Das „Jugendheim” ist das Domizil des ‚Bund für Gotterkenntnis‘ – seit 1973 finden hier rechtsextreme Veranstaltungen statt. Dabei handelt es sich nicht nur um Veranstaltungen des Vereins selbst: Immer wieder öffnet man die Türen für geheime Vernetzungstreffen der Neonazi-Szene.
Die Journalisten
Timo Büchner hat sich auf die Berichterstattung zu der extremen Rechten in Süddeutschland spezialisiert. Er schreibt als freier Journalist unter anderem für das Hohenloher Tagblatt.
Jens Sitarek arbeitet seit 2014 als Redakteur und Reporter beim Hohenloher Tagblatt. In dem Rechercheteam war er nach eigenen Aussagen der „Arm in die Lokalzeitung“. Er wuchs in der Lüneburger Heide auf, wo ihm die ‚Ludendorffer‘ schon bei ihren Ostertagungen begegneten.
Harald Zigan war von 1978 bis 2021 Redakteur beim Hohenloher Tagblatt. Eigentlich sei er offiziell im Ruhestand, doch als freier Journalist schreibt er weiter für die Lokalzeitung. Er beschäftigt sich seit 1985 mit den ‚Ludendorffern‘.