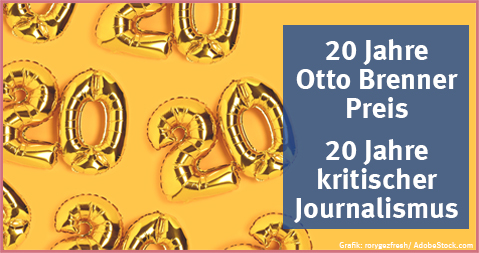„Ich bin nicht der Kämpfer von Natur aus”
Otto-Brenner-Preisträger Günter Wallraff im Gespräch
Günter Wallraff wurde 2024 für sein Lebenswerk die ‚Besondere Auszeichnung‘ des Otto Brenner Preises verliehen. Wir treffen den mittlerweile 82-jährigen Preisträger in seinem kleinen, ausgebauten Gartenhäuschen in einem ruhigen Hinterhof in Köln-Ehrenfeld. Bei etlichen Espressi und ein paar Nüssen erzählt der Pionier des Investigativjournalismus, warum seine Undercover-Recherchen eine Identitätssuche darstellen, wie die Arbeit bei seiner RTL-Sendung Team Wallraff abläuft und was ihm der Otto Brenner Preis bedeutet.
Die Fragen stellten Charlotte Theis, Hannah Simon und Amelie Gensel.
Das Interview wurde am 4. Februar 2025 geführt.
Herr Wallraff, Sie haben vergangenen Oktober den Otto Brenner Preis für Ihr Lebenswerk erhalten. Was bedeutet dieser Preis für Sie? Ihr erster war es ja nicht.
Was für andere das Bundesverdienstkreuz sein mag, ist für mich diese Auszeichnung. Eine Rückkehr zu meinen Anfängen, als Jakob Moneta, Chefredakteur der Gewerkschaftszeitung Metall meine Reportagen, etwa bei Thyssen oder der Werft Blohm+Voss, gegen größte Widerstände durchgesetzt und veröffentlicht hat. Schon lange vor meiner wohl bekanntesten Rolle als türkischer Leiharbeiter Ali malochte ich als Deutscher bei Thyssen ein halbes Jahr in den Staubschächten und veröffentlichte in der Gewerkschaftszeitung eine Serie über die miserablen Arbeitsbedingungen. Schon damals versuchten die Firmen meine Veröffentlichungen zu verhindern, sodass meine Reportagen erstmal ohne Namensnennung oder unter Pseudonym erschienen.
Haben Sie in Ihrem Berufsleben viel darüber nachgedacht, wie erinnerungswürdig diese Arbeit ist?
Nein, eher nicht. Zu meinem Berufskreis – Journalisten, Schriftsteller, Künstler – zählen häufig Menschen, die ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, manchmal sogar ein übertriebenes. Im Vergleich zu denen habe ich eher ein unterentwickeltes. Vielleicht ist dadurch auch die Möglichkeit entstanden, mich in andere hineinversetzen zu können, mich in andere Rollen zu begeben. Mal sind es Menschen in Fabriken oder in der Paketbranche, mal ist es die Rolle des Zugewanderten, mal die der Menschen im Obdachlosenasyl. Ich war Einzelgänger, und auch heute würde ich sagen, dass ich mich eher denen zugehörig fühle, die nicht dazugehören. Durch dieses existenzielle sich Aussetzen habe ich so etwas wie Selbstbewusstsein und meine soziale Zugehörigkeit entwickelt. Ich würde behaupten, so habe ich meine Identität hergestellt. An erster Stelle ist das also kein Arbeitsprinzip. Es ist auch eine Identitätssuche und letztendlich eine Identitätsfindung.
Welche Rolle hat Ihre unfreiwillige Zeit bei der Bundeswehr bei dieser Identitätsfindung gespielt? Hat das Ihre journalistische Laufbahn geprägt?
Ja, die war prägend. Ich bin ein eher versöhnlicher Mensch. Ich bin nicht der Kämpfer von Natur aus. Ich habe kein Feindbild. Allerdings, wenn man die Taten von Trump und Musk sieht, oder was mit der AfD passiert, dann entsteht eine Auflehnung, eine Kraft zu sagen: „Das kann man nicht hinnehmen.“ Aber erstmal sehe ich in jedem Menschen auch die positiven Seiten. Rückblickend habe ich der Bundeswehr zu verdanken, dass ich eine Rolle in der Gesellschaft gefunden habe und auch ein Widerstandspotenzial entwickelt habe. Bei der Bundeswehr wurde ich hellwach. Da wurde aus dem Träumer ein bewusster Mensch. Ich war als Kriegsdienstverweigerer in der Armee, wo damals noch Nazis das Sagen hatten. Da wurden Nazilieder gegrölt, es gab judenfeindliche Sprüche und Holocaust-Verharmlosung. Dort habe ich zehn Monate durchgehalten. Ich habe mich geweigert eine Waffe anzufassen und musste mir einiges einfallen lassen, um dem Drill und Kadavergehorsam etwas entgegenzusetzen: Wenn morgens alle zu den Gewehren flitzten, steckte in jeder Mündung eine kleine Feldblume. Großes Gelächter. Man versuchte mit allen Methoden, meinen Willen zu brechen. Meine Vorgesetzten ließen mich auf Gewaltmärschen als Allerletzten marschieren und statt eines Gewehrs einen Stock schultern. Wenns durch die Dörfer ging, habe ich an den Stock noch einen Strauß Blumen gebunden und hatte die Lacher auf meiner Seite. Als die Bundeswehr merkte, dass ich an einem Tagebuch schrieb und im Jugendmagazin Twen veröffentlichen wollte, bot man mir an, mich sofort in die Freiheit zu entlassen. Allerdings mit der Auflage, zu unterschreiben, dass ich über meine zehnmonatige Verweigerungszeit bei der Bundeswehr nichts veröffentliche! Das lehnte ich ab. Um mich unglaubwürdig zu machen, wurde ich daraufhin in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie des Bundeswehrlazaretts Koblenz eingewiesen. Nach eineinhalb Wochen hat man mich mit dem Prädikat Tauglichkeitsgrad VI, „abnorme Persönlichkeit, für Frieden und Krieg untauglich” wieder in die Freiheit entlassen. Das war damals eine Irritation für mich.
Das könnte auch ein Kompliment sein?
Ja, heute würde ich sagen: Für mich ist das ein Ehrentitel.
„Ich habe kein Feindbild”
Ihre Arbeit hatte immer auch eine aktivistische Komponente: Denken Sie an das Anketten auf dem Syntagma-Platz in Athen. Journalismus versus Aktivismus – das wird gerade oft diskutiert. Wo ziehen Sie heute die Grenze?
Also für mich ist der Begriff Aktivismus nichts Negatives. Es gehört dazu. Bin ich Journalist im eigentlichen Sinne? Sicher gehöre ich dazu, aber es ist manchmal auch eine Menschenrechtsinitiative. Die Grenze verläuft fließend. Es ist auch ein Arbeitsprinzip, das kann man nicht ganz trennen. Am prägendsten waren für mich sicherlich die Erfahrungen, die ich 1974 als politischer Häftling in Griechenland machte. Um politische Gefangene aufzuspüren, die während der Militärdiktatur im faschistischen Griechenland als verschollen galten, und um die Zustände im Land stärker ins Bewusstsein zu bringen, reiste ich nach Athen. Ich kettete mich auf dem Syntagma-Platz vor dem weggeputschten Parlament an einen Lichtmast und begann, Flugblätter zu verteilen. Sofort waren Geheimpolizisten da und schlugen mich noch an Ort und Stelle zusammen. Weil man mit allem rechnen musste, hatte ich zuvor mein Testament verfasst. In den Verhören wurde ich gefoltert. Das Buch hatte keine hohe Auflage, aber rückblickend war das für mich eine der wichtigsten, prägendsten Rollen meines Lebens.
Und wie würden Sie sich dann heute vorstellen, wenn man Sie fragt?
Ich bin Journalist, Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist.
Für Ihre Insider-Recherchen haben Sie sich mehrfach verkleidet, um nach außen eine andere Identität zu erlangen. Welche Ihrer Undercover-Rollen beschäftigt Sie noch heute?
Das Schicksal obdachloser Menschen. Ich habe ein halbes Jahr als Obdachloser gelebt und das beschäftigt mich privat bis heute. Auch hier in Deutschland nimmt die Verelendung zu und immer mehr Menschen werden obdachlos und müssen unter unwürdigen Bedingungen leben. Das passt zur Lage der Nation, in der die Superreichen immer reicher werden und die Armen immer zahlreicher. Und man kann immer Einzelnen helfen: Wenn ich einen Menschen rette, dann mache ich etwas Sinnvolles. Es sind immer wieder Einzelschicksale. Einigen konnte ich eine Wohnung vermitteln oder habe sie bei uns wohnen lassen, zu einigen habe ich immer noch regelmäßig Kontakt und es sind Freundschaften entstanden.
Was haben Sie getan, damit solche Rollen Sie nicht zu sehr vereinnahmen?
Vereinnahmen ist der falsche Begriff; Annäherung, Zugehörigkeit, darum gehts mir. Ich bin in meinen Rollen mit Menschen zusammen, die unter unwürdigen Zuständen leiden. Da werde ich einer von ihnen. Man sagt ja, der Journalist muss Distanz halten. Es gibt dieses meistmissbrauchte Zitat von Hanns Joachim Friedrichs: Einen guten Journalisten erkenne man daran, dass er sich nicht gemein mache mit einer Sache – auch nicht mit einer guten. Man muss zu Friedrichs’ Ehrenrettung sagen, dass er sich auch selbst immer wieder mit einer guten Sache „gemein gemacht“ hat. Zum Beispiel, als er als Sportreporter des ZDF anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft über die Menschenrechtsverletzungen des argentinischen Militärregimes sehr engagiert und parteiisch berichtete. Meine Meinung ist: Als Journalist hat man die Pflicht, sich auf Seiten der jeweils Schwächeren zu stellen, aber ohne sich instrumentalisieren zu lassen.
Erreichen Sie manchmal Hilferufe oder Anfragen von Privatpersonen?
Ja, zahlreiche, fast täglich und ich trenne hier nicht zwischen ‚wichtig‘ und ‚unwichtig‘. Scheinbar unwichtige Menschen sind oft für mich die wichtigeren. Die Hälfte meiner Tätigkeit hängt nicht mit Veröffentlichungen zusammen. Das sind dann Schicksale, die mir nahe gehen und dann nehme ich mir genauso viel Zeit zu helfen, wie für meine eigentliche Arbeit. Aber ich muss gestehen, oft habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich den Erwartungen nicht gerecht werden kann.
„Man muss den Menschen unvoreingenommen begegnen.”
Thema ‚undercover gehen‘: Was war der Antrieb hinter Ihren Recherchen?
Ich will etwas unter Beweis stellen. Und ich will auch, dass sich etwas ändert. Dass die Menschen, die meine Texte lesen oder Reportagen sehen, ermutigt werden, Missstände nicht einfach hinzunehmen und sich nicht mehr alles gefallen lassen, sensibilisiert werden.
Was sollte man denn charakterlich mitbringen, um die mentalen und auch physischen Belastungen von Undercover-Einsätzen durchzustehen?
Man sollte erstmal einiges hinter sich lassen. Und sich voll darauf einlassen. Man hat seine soziale Orientierung, man hat sein Gerechtigkeitsempfinden – das kann und darf man nicht hinter sich lassen. Aber man sollte die Menschen nicht nach Ansehen, nach Beruf, nach Ausbildung oder nach Wissen beurteilen. Ich habe oft erlebt, dass Menschen, die keine höhere Schul- oder Universitätsbildung hatten, eine umso überzeugendere Herzensbildung haben. Man muss den Menschen unvoreingenommen begegnen.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie sich vorher keine Gedanken darüber machen, was Ihre Recherchen auslösen könnten. Was war für Sie die bedeutendste Veränderung, die Sie durch eine Veröffentlichung anstoßen konnten?
Also ich würde schon sagen, dass meine über zweijährige Rolle für mein Buch Ganz unten als türkischer Leiharbeiter oder ‚Gastarbeiter‘ wie es früher hieß, die nachhaltigste Wirkung hatte. Bis heute sprechen mich immer wieder Menschen darauf an und erzählen, was das Buch bei ihnen ausgelöst hat. Ob etwas Erfolg hat oder nicht, ist am Anfang kein Motiv für mich. Ich bin von meiner Arbeit überzeugt. Mittlerweile gibt es Buchverlage, die bei neuen Einsendungen die sogenannte KI befragen: Hat das Buch eine Chance oder nicht? Ich frage mich, was wohl früher in meinem Falle die Antwort gewesen wäre. Hätte die KI gesagt: „Völlig abwegig“? Mein Verlag stand zum Glück immer hinter mir.
Apropos ‚Gastarbeiter‘: Lernen Sie Ihre Legenden vorher auswendig?
Nein und das ist auch gut so! Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Ich gehe unvoreingenommen rein und improvisiere vieles. Es ist meist anders, als man es sich vorstellt. Und dann entsteht eine neue Sicht – für mich selbst, aber auch für den Leser. Wenn du vorher mit einem ganz bestimmten Vorwissen und Plan in eine Recherche gehst, bist du nicht mehr so offen.
Überlegen Sie sich denn im Vorfeld Eckdaten - zum Beispiel was die familiäre Geschichte des Gastarbeiters Ali ist?
Ja, ich habe einzelne Eckpfeiler, aber manchmal ist das auch schwierig. Für die Ali-Rolle bin ich an einem Sprachkurs für Türkisch gescheitert, aber Not macht erfinderisch: Ich habe dann gesagt, ich sei bei meiner griechischsprachigen Mutter aufgewachsen. Zum Glück hatte ich bei Thyssen, auf Baustellen und bei McDonald’s keine griechischen Kollegen. Als trotzdem einmal einer meiner türkischen Arbeitskollegen bei Thyssen misstrauisch wurde und mich aufforderte: "Sprich doch mal Griechisch!", kamen mir meine rudimentären Altgriechisch-Schulkenntnisse zugute. So konnte ich den Anfang der "Odyssee" von Homer wortwörtlich aufsagen. Dann war das Vertrauen wiederhergestellt! Man lernt doch nie umsonst im Leben! (lacht)
Haben Sie bei all dem Eintauchen in fremde, fiktive Identitäten manchmal vergessen, wer eigentlich Günter Wallraff ist?
Da sagen Sie was! Wer bin ich denn? Unsere Geburt, unsere soziale Herkunft ... Das sind alles Zufälligkeiten. Wenn ich in einer Rolle drin bin, dann bin ich fast identisch. Dann träume ich manchmal nachts in der neuen Identität.
Sind Sie der Meinung, dass Journalist*innen Gesetze brechen dürfen, um wichtige Erkenntnisse zu erlangen?
Nein, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat, auch wenn manche versuchen, diesen abzuschaffen. Aber als ich anfing, da habe ich unter anderem Namen und mit anderer Identität gearbeitet. Das war formal ein Gesetzesverstoß, um Unrecht sichtbar zu machen. Meine Arbeit wurde immer wieder von Prozessen begleitet, jahrelang vor allem durch Springer. Sie versuchten, meine Arbeit zu kriminalisieren, und konstruierten dafür den sogenannten „Tatbestand des Einschleichens“. Der Bundesgerichtshof hat schließlich entschieden: Wenn es um gravierende Missstände geht, hat die Öffentlichkeit ein Recht, darüber informiert zu werden, auch wenn die Erkenntnisse unter anderer Identität zustande kommen. Durch die sogenannte „Lex Wallraff“ sind deshalb bis heute Undercover-Einsätze vom BGH und Bundesverfassungsgericht abgesichert.
Würden Sie heute undercover bei der AfD vorbeischauen?
Danke für die Anregung, höchste Zeit, bevor es wieder mal zu spät ist. In den 1960er‑Jahren habe ich mir mal die NPD vorgenommen. Da war ich zu unbekümmert und bin relativ früh aufgeflogen.
„Wenn ich nicht mehr bin, besteht das Team weiter”
Nach dieser vielfältigen Laufbahn haben Sie Ihrer Karriere mit „Team Wallraff“ bei RTL einen zweiten Frühling beschert. Was hat Sie dazu bewogen?
Ich bin auf RTL zugegangen, weil ich in der Vergangenheit mit den öffentlich-rechtlichen Sendern gravierende Probleme hatte. Nicht mit den Redakteuren, sondern mit den Hausjuristen und Sendergewaltigen, hinter denen manchmal auch politische Interessen standen. Mein Film über die Machenschaften der Bild-Zeitung zum Beispiel lag deswegen über Jahrzehnte im Giftschrank des WDR. Oder mein Dokumentarfilm Ganz unten, mit versteckter Kamera aufgenommen, der für den 1. Mai in den Programmzeitschriften in der ARD angekündigt war und nach Intervention aus Bayern abgesetzt wurde. Im Ausland wurde der Film mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und im TV ausgestrahlt, zum Beispiel im niederländischen Fernsehen extra mit deutschen Untertiteln, damit ihn wenigstens die deutschen Grenzbewohner sehen konnten. Nach solchen Erfahrungen bin ich dann vor circa zehn Jahren auf RTL zugegangen, ob sie sich ein Format vorstellen könnten, bei dem auch große Werbekunden nicht geschont werden, und sie haben zugesagt. Der Privatsender bot mir jedenfalls einen Freiraum, den ich bei ARD und ZDF nicht bekommen habe. Daraus entstand dann das Team Wallraff.
Welche Sendung bei RTL haben Sie zuletzt gesehen?
Vorige Nacht noch, da lief so ein Format, das hab ich mir ein paar Minuten angesehen, als ich nicht einschlafen konnte, mit dem konnte ich aber nichts anfangen ... (grübelt)
Das Dschungelcamp?
Ja! Aber gerade deshalb hat Team Wallraff auch die Chance, Zuschauer zu erreichen, die das öffentlich-rechtliche TV-Programm kaum nutzen.
Sind Sie eigentlich mittlerweile zu bekannt, um selbst undercover zu gehen?
Nein, ich bin beim Team Wallraff auch undercover unterwegs gewesen. Zum Beispiel vor einigen Jahren in der Rolle eines Investors oder in einem Pflegeheim und habe einen Dementen gespielt. Das war eine dankbare Rolle, denn ich konnte nachts überall herumgeistern und mir alles anschauen. Man müsste es wiederholen, denn die Zustände in der Pflege werden von Jahr zu Jahr schlimmer. Für die Beschäftigten, aber vor allem für die Pflegebedürftigen.
Welche Unterschiede merken Sie bei der Arbeit im „Team Wallraff“?
Dort sind jüngere, hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich sehe, wie ernst sie das angehen und sich solchen Recherchen auch längerfristig aussetzen. Je länger man in der Rolle bleibt, umso mehr identifiziert man sich mit ihr. Das Engagement, die Entbehrungen finde ich bemerkenswert – im Team Wallraff, aber vor allem auch im Ausland, zum Beispiel bei Fabrizio Gatti in Italien, Florence Aubenas in Frankreich, in Mexiko Lydia Cacho oder Anas Aremeyaw Anas in Ghana. Sie haben sich auch durch persönliche Begegnungen von mir inspirieren lassen und mich zum Vorbild genommen. So sind sie auch für mich inzwischen zu Vorbildern geworden.
Bei „Team Wallraff“ arbeiten Sie in einem Team. Wie unterscheidet sich das von Ihren Solo-Recherchen?
Meine früheren Recherchen habe ich meist im Alleingang entwickelt und durchgesetzt. Beim Team Wallraff diskutieren und planen wir Themen im Team. Ich spreche mit Informanten und bringe Erfahrungen und Ideen ein. Das ist eine wirkliche Gemeinschaftsarbeit. Und wenn ich nicht mehr bin, besteht das Team weiter, so hoffe ich.