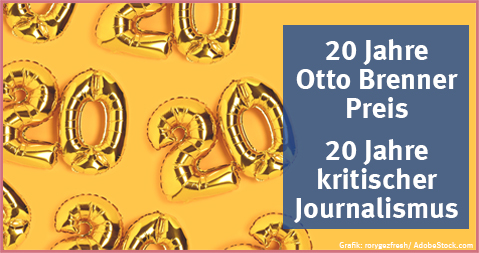Ein strategisches Scheitern
Impact der preisgekrönten Kabul-Recherche von Christian Schweppe
Christian Schweppe hat in seinem Artikel „Wahnsinn. Eine Riesenscheiße“ einen gewaltigen Politskandal aufgedeckt. Umfassend beschreibt er das Scheitern der Bundesregierung beim Abzug aus Afghanistan. Die öffentliche Empörung war groß – aber wie reagierte der Staat auf die Enthüllung? Welchen Beitrag konnte sein Artikel zur politischen Aufklärung dieses Staatsversagens leisten?
Von Maira Mellinghausen und Julia Pulm
Es sind Bilder, die im Sommer 2021 die ganze Welt erschüttern: Tausende Afghaninnen und Afghanen, die auf das Rollfeld des Kabuler Flughafens stürmen, die Soldaten verzweifelt anflehen, sie mitzunehmen, sich an abhebenden Flugzeugen festklammern. Die Taliban übernehmen die Macht in Kabul – und die Bundeswehr ist maßlos überfordert. Sie zieht in einem riesigen Chaos ab und lässt tausende afghanischen Ortskräfte, welche die letzten 20 Jahre für die deutsche Bundesregierung gearbeitet haben, zurück. Die Frage, wie die damalige Bundesregierung so versagen konnte, blieb von staatlicher Seite lange unbeantwortet, sie wurde umschifft.
Einer, der die Antwort gefunden und veröffentlicht hat, ist Christian Schweppe. Dem freien Investigativjournalisten, der sich seit mehreren Jahren mit Afghanistan beschäftigt, wurden 220 Gigabyte interner Regierungsdokumente zugespielt. Daraus rekonstruierte er ein erschreckendes Ausmaß an Ignoranz und Fahrlässigkeit von Seiten der damaligen Bundesregierung und des Bundesnachrichtendienstes (BND) gegenüber der Situation in Afghanistan. Die Ergebnisse seiner umfangreichen Recherche, die Januar 2024 von der ZEIT veröffentlicht wurde, lösten ein öffentliches Echo sondergleichen aus. „Ich habe noch nie so viele Rückmeldungen auf einen Text bekommen. Und das aus ganz unterschiedlichen Richtungen“, erinnert sich Schweppe.
Seine Recherche führte dazu, dass das Thema Afghanistan, zweieinhalb Jahre nach den fatalen Ereignissen in Kabul, wieder auf der medialen Tagesordnung stand – und auch blieb. Diverse Medien griffen Schweppes Artikel auf, baten ihn zum Interview, zitierten seine Ergebnisse. Im August 2024 strahlte das ZDF die Dokumentation „Geheimakte Kabul“ aus, in welcher die Ergebnisse von Schweppes Recherche filmisch dargestellt und weiter ausgeführt wurden.
Die Resonanz aus der journalistischen Community ist dabei eindeutig positiv ausgefallen. Neben dem 1. Preis in der Kategorie „Allgemein” des Otto Brenner Preises ist Schweppe im Dezember 2024 auch mit dem Reporter:innen-Preis für die beste freie Reportage ausgezeichnet worden. Dank der Auszeichnungen und des anhaltend positiven Feedback von Kolleg:innen und Publikum fühlte sich Schweppe in der Wichtigkeit seiner Recherche bestätigt: „Das zeigt, dass das Interesse da und die Empörung immer noch groß ist. Deswegen ist es so wichtig, das Thema Afghanistan weiter zu debattieren und auch tatsächlich politische Lehren daraus zu ziehen.”
Doch welche Lehren wurden tatsächlich bis heute gezogen und welche Rolle hat die journalistische Berichterstattung dabei gespielt? Welche Reaktionen und Konsequenzen gab es von staatlicher Seite auf das durch Schweppe nachgezeichnete Versagen?
Eine vernichtende Bilanz
Die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel sowie der BND waren stets bemüht zu betonen, dass man die Machtergreifung der Taliban nicht habe kommen sehen. Da die Bundestagswahl kurz bevorstand, blieben die staatlichen Bemühungen zur Aufklärung zunächst überschaubar. Ein Jahr nach dem Fall Kabuls setzte der neu gewählte Bundestag unter der Ampel-Regierung zwei Gremien ein, welche sich mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan generell sowie spezifisch mit den Ereignissen im Sommer 2021 befassen sollten. Über diese parlamentarische Aufarbeitung, welche im Januar 2025 ihr vorläufiges Ende fand, berichtete Schweppe für verschiedene Medienhäuser.
Zum einen gab es die Enquete-Kommission Afghanistan-Einsatz. Sie wurde eingesetzt, um Lehren aus der 20-jährigen Bundeswehrmission am Hindukusch für die zukünftige Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik zu ziehen. Am 27. Januar 2025 legte die Kommission ihren Abschlussbericht vor – und kam zu einem vernichtenden Ergebnis. Viele von Schweppes Erkenntnissen finden sich in dem Abschlussbericht wieder: Die Kommission attestiert der Bundesrepublik ein „mangelndes Wissen über die tatsächliche Lage in Afghanistan“ und wirft ihr eine ineffektive Kommunikation und Koordination auf nationaler wie auch internationaler Ebene vor. Es werden strukturelle Mängel in der Fehlerkultur, Evaluierung und dem institutionellen Lernen hervorgehoben sowie die Schutzverantwortung Deutschlands gegenüber den afghanischen Ortskräften deutlich unterstrichen. Insgesamt spricht die Enquete-Kommission von einem strategischen Scheitern.
Die Bedeutung der Lehren und Empfehlungen der Enquete-Kommission schätzt Christian Schweppe als hoch ein: „Auch wenn aktuell das sicherheitstechnische Interesse eher auf Landes- und Bündnisverteidigung liegt und nicht mehr so stark auf internationalen Hilfsmissionen – sowas wie in Afghanistan kann ja immer wieder passieren. Für Länder wie Syrien oder die Ukraine sind die Lehren mit Sicherheit wichtig.” Die Rolle journalistischer Recherchen ist in dem Bericht der Enquete-Kommission nicht direkt ersichtlich. Anders sieht es im Abschlussbericht des zweiten Gremiums, dem eingesetzten Untersuchungsausschuss, aus.
Schonungslose Kritik und aufwendige Aufarbeitung
Der Afghanistan-Untersuchungsausschuss übergab seinen Abschlussbericht Mitte Februar 2025 an die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD). Dieser arbeitet die Ereignisse zwischen dem Abschluss des Doha-Abkommens Ende Februar 2020 und der chaotischen Evakuierung am Flughafen Kabul im September 2021 auf. Auf den über 1.400 Seiten werden zahlreiche Nachlässigkeiten festgestellt: Eine mangelhafte Krisenreaktion der Bundesregierung, unkoordinierte Lagebeurteilungen innerhalb der Ressorts und ein fehlerhafter Umgang mit den Ortskräften. Ähnlich wie bei der Enquete-Kommission wurde vieles von dem, was Schweppe in seinem Artikel aufgedeckt hat, auch im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses festgestellt. „Der Bericht bestätigt, was wir berichtet haben: Dass Kabul in der Tat ein deutsches Staatsversagen war“, bekräftigt Schweppe.
Ein deutsches Staatsversagen, das kaum öffentliche Resonanz auslöste: Beide Abschlussberichte wurden im Bundestag vor halbleerem Plenum debattiert. Das hatte wohl aber auch mit unglücklichem Timing zu tun: In der gleichen Woche Ende Januar 2025 brachte die Unionsfraktion einen höchst umstrittenen Gesetzesvorschlag zur Begrenzung von Migration in den Bundestag ein und nahm für dessen Annahme Stimmen der AfD in Kauf. Die öffentliche und politische Aufregung war groß, sodass die Ergebnisse der beiden Gremien auch in der Berichterstattung in dieser politisch durchaus historischen Woche untergingen.
Wie wichtig journalistische Berichterstattung für solche Aufarbeitungen ist, wird im Untersuchungsausschuss jedoch sichtbar. Einerseits diente diese zur zeitlichen Rekonstruktion der Ereignisse. Andererseits nahm der Untersuchungsausschuss auf Berichte unterschiedlicher Medienhäuser Bezug, um die Geschehnisse in Afghanistan einzuordnen und die Beweisführung zu untermauern. Im Gespräch erzählt Schweppe, dass Filmszenen aus seiner ZDF-Dokumentation während einer Debatte des Untersuchungsausschusses im Saal gezeigt wurden. Sein preisgekrönter Artikel wird zur Rekonstruktion der Beweismittellage seitens des Untersuchungsausschusses hingegen nicht zitiert. Ganz unerwähnt bleibt der ZEIT-Artikel jedoch nicht.
Im Fadenkreuz
Auf Anfrage bei den ständigen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, ob und inwiefern Schweppes Berichterstattung eine Rolle in der Ausschussarbeit geleistet hat, bestätigt der Ausschussvorsitzende Ralf Stegner (SPD), dass diese „in politischen Kreisen mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen worden ist.“ Diese Aufmerksamkeit richtete sich laut Schweppe jedoch nicht nur auf den inhaltlichen Mehrwert seines Artikels: Nach der Veröffentlichung im Januar 2024 hätten insbesondere Stegner sowie die ehemalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) Interesse daran gezeigt, die Identität jener Quellen zu ermitteln, die Schweppe die 220 Gigabyte interner Regierungsdokumente zugespielt hatten. Der Ausschussvorsitzende bat Bas in diesem Zuge, die Staatsanwaltschaft Berlin zur Strafverfolgung gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrats zu ermächtigen – was sie tat. Dieses Geschehen lässt sich auch schwarz auf weiß im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses nachlesen. Unter dem Abschnitt „Veröffentlichung von vertraulichen Informationen” heißt es in einer Stellungnahme des Auswärtigen Amts, dass jenes Datenleck ein „äußerst [schädlicher] Vorgang“ gewesen sei, durch den ein „erheblicher Vertrauensverlust“ in BND und Bundesregierung sowie eine „Verschlechterung der Informationszugänge für die Bundesregierung im Ausland“ drohe. Diese Stellungnahme liest sich wie eine offene Missbilligung von Schweppes journalistischer Aufarbeitung.
Es waren nicht nur Stegner und Bas, die hinter Schweppe und seinen Quellen her waren: Auch der BND hatte es darauf abgesehen, seine Berichterstattung zu diskreditieren. So beschreibt Schweppe in einem Erfahrungsbericht für die Zeitschrift Communicatio Socialis, dass der BND-Pressesprecher nach der Veröffentlichung des Artikels begann, seine Auftraggeber – ohne sein Wissen – zu kontaktieren und seine Berichterstattung in Frage zu stellen. Es folgten persönliche Anrufe des Pressesprechers bei Schweppe, mit unterdrückter Nummer. Statt sich einschüchtern zu lassen, entschied sich der freie Journalist dazu, erneut zu Kabul zu veröffentlichen. Die Dokumentation für das ZDF entstand. Doch auch hier mischte sich der BND laut Schweppe wieder ein und versuchte, die Produktion durch E-Mails an ZDF-Mitarbeitende zu beeinflussen.
Dieses Verhalten ist durchaus als alarmierendes Zeichen für die freie Presse in Deutschland zu verstehen. Auch in der Aufforderung und Ermächtigung zu strafrechtlichen Ermittlungen durch die Bundestagspräsidentin sieht Schweppe eine negative Entwicklung – schließlich ginge es um journalistische Quellen. „Das ist sehr klar einzuschätzen als Journalist. Es bleibt oft unterbelichtet dass die Pressefreiheit uns in Deutschland auch Recherchefreiheit gibt“, unterstreicht er. „Natürlich soll Recherche in den Leitplanken erfolgen, dass keine Gesetze gebrochen werden – und das wurden sie hier auch nicht. Meine Quellen wurden durch diese Versuche nicht offengelegt, denn ich nehme Quellenschutz sehr ernst.“
Trotz der Einschüchterungsversuche steht Schweppe fest hinter seiner Berichterstattung: „Das alles öffentlich zu machen, war meine Pflicht ab dem Augenblick, in dem das Datenmaterial bei mir eingetroffen war. Bis heute gilt doch schließlich für uns: Die Presse hat den Regierten zu dienen – nicht den Regierenden.“ Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin gegen Unbekannt sind laut Schweppe im Mai 2025 eingestellt worden.
Nach oben gefallen
Bei der juristischen Aufarbeitung, wer für das Versagen in Kabul verantwortlich ist, zeigte man hingegen deutlich weniger Entschlossenheit. Wie in Schweppes Bericht zu lesen, wurde niemand der Verantwortlichen entlassen, ebenso sei keine Person zurückgetreten. „Ich kann das bis heute niemandem erklären – und es kann auch mir niemand erklären – wie nach einem solch breiten Staatsversagen ministerienübergreifend nicht eine Person personell irgendwelche Konsequenzen erfahren hat”, sagt Schweppe. Auch von Mitarbeitenden aus den Ministerien selbst werde ihm die Empörung darüber gespiegelt. Im Untersuchungsausschuss habe Schweppe darüber hinaus beobachtet, wie verantwortliche Spitzenpolitiker wie Horst Seehofer (CSU, Innenminister a. D.) oder Heiko Maas (SPD, Außenminister a. D.) in Zeug:innenaussagen sogar offenkundig geschützt wurden, mit der Begründung, dass man doch ihr Ansehen nicht so schädigen könne. Im Aufwiegen von Menschenleben gegen politische Karrieren hätten letztere schwereres Gewicht bewiesen: So fänden sich laut Schweppe beteiligte Spitzenpolitiker*innen heute entweder im Ruhestand, als Regierungsberater*innen oder Botschafter*innen wieder. Alle Beteiligten seien nach oben gefallen. In dem im Februar 2025 veröffentlichten Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses wurden nun zumindest die Namen von Verantwortlichen, etwa Heiko Maas, deutlich benannt. Doch die Übernahme von Verantwortung bleibt aus. Bis heute gibt es keine offizielle Entschuldigung von Seiten der deutschen Bundesregierung an die zurückgelassenen afghanischen Ortskräfte.
In Anbetracht der Tatsache, dass es keine juristischen oder personellen Konsequenzen gab, wirkt die Einleitung von Ermittlungen gegen Schweppes Quellen geradezu zynisch. „Es zeugt von einem doch fragwürdigen Amtsverständnis, wenn im Bundestag nicht alle Kraft in die Aufarbeitung der deutschen Versäumnisse im Fall Kabul gesteckt wurde, sondern stattdessen in die Kritik der freien Presse, die genau diese Aufarbeitung dann geleistet hat“, sagt der freie Journalist. Es ginge auch um mehr als einen potenziellen Vertrauensverlust in den BND: „Politisch wirft dieses Afghanistankapitel einen Schatten auf die deutsche Diplomatie und auf die Rolle der deutschen Außenpolitik in der Welt. Wie soll sich denn je wieder eine deutsche Ortskraft darauf verlassen können, dass sie in einer Gefahrensituation rausgeholt wird?”, kritisiert Schweppe.
Medialer Rückhalt ist wichtig
Neben den Evakuierungsmaßnahmen der Bundesregierung versuchte auch die deutsche Initiative „Kabul Luftbrücke” Ortskräfte aus Afghanistan zum Zeitpunkt des Truppenabzugs auszufliegen. Bis heute bemüht sich die Initiative um die Aufnahme gefährdeter Personen nach der Machtergreifung der Taliban. Mediale Sichtbarkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. „Die Medienpräsenz hat Auswirkungen auf die Gespräche mit Politiker:innen, die wir führen“, sagt die Pressesprecherin der Kabul Luftbrücke, Eva Beyer. „Wenn kein öffentlicher Rückhalt da ist, können wir keinen politischen Druck aufbauen.“
Für den Artikel von Schweppe findet Beyer deshalb nur lobende Worte: „Der Artikel geht in die Tiefe und zeigt auf, was wirklich passiert ist. Da ist ein Verständnis für den ganzen Kontext da.“ Ebenso sieht sie den Artikel als einen wichtigen Zusatz zur Aufarbeitung in der Enquete-Kommission und im Untersuchungsausschuss: „Daraus hätten auch die Lehren für das Bundesaufnahmeprogramm gezogen werden müssen.” Aber letzteres sei nicht wirklich passiert.
Das Bundesaufnahmeprogramm wurde im Oktober 2022 von der Bundesregierung initiiert. Jeden Monat sollten bis zu 1.000 besonders gefährdete Afghan:innen in Deutschland aufgenommen werden. Nur ein Bruchteil davon wurde bislang nach Deutschland ausgeflogen. Im März 2023 wurde das Bundesaufnahmeprogramm erstmals für drei Monate vorübergehend gestoppt. Grund dafür seien „konkrete Hinweise auf mögliche Missbrauchsversuche” gewesen, hieß es damals seitens des Auswärtigen Amtes.
Seit Ende 2024 wurden keine Aufnahmezusagen mehr erteilt. Bereits erteilte Zusagen behalten zwar ihre Gültigkeit, doch faktisch ist das Programm eingestellt. Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz (CDU) spricht sich darüber hinaus deutlich gegen eine Weiterführung des Programms aus. Die Aufnahme gefährdeter Afghan:innen über das Bundesaufnahmeprogramm wird seitdem immer wieder kontrovers diskutiert, während die tragischen Bilder am Flughafen Kabul 2021 langsam verblassen. Es ist eine Katastrophe für alle zurückgelassenen Ortskräfte.
Die Sprecherin von Kabul Luftbrücke findet, dass Journalismus noch mehr leisten müsse, um den tragischen Folgen des Truppenabzugs mediale Präsenz zu verschaffen. So könnten zum Beispiel noch viele Geschichten darüber erzählt werden, warum das Bundesaufnahmeprogramm so kläglich gescheitert sei, meint Beyer. Dazu gehöre auch eine Redaktion, die das unterstützt und finanziert. Deswegen seien solche Preise wie der Otto Brenner Preis „wichtig, denn sie zeigen, dass es sich lohnt.“
Ein Bericht, der nachhallt
Auf der Suche nach der Frage, welchen Impact der Artikel von Christian Schweppe hatte, taucht immer wieder ein Wort auf: Aufmerksamkeit. Und genau das ist es auch, was der Journalist darunter versteht: „Impact heißt, wenn ich mit einer Veröffentlichung oder einer Recherche tatsächlich neue Öffentlichkeit und neue Aufmerksamkeit und neue Debatten angeschoben habe.” Und das hat er mit seiner Recherche durchaus getan. Auch wenn einzelne Chefredakteure immer wieder Desinteresse an Afghanistan gezeigt hätten, hat Schweppe an dem Thema festgehalten: „Ich hatte über die Jahre den Eindruck, dass gerade der Umgang mit den Ortskräften die Menschen total interessiert – und sie total empört. Dass die Leserinnen und Leser die große Bedeutung davon sehr gut verstehen.”
Schweppes akribische Arbeit und sein Festhalten am Thema Afghanistan haben sich ausgezahlt. Sowohl auf journalistischer, politischer als auch zivilgesellschaftlicher Ebene hat sein Bericht ein großes Echo ausgelöst und mehr Sichtbarkeit für die katastrophale Situation in Afghanistan geschaffen. Die Auszeichnungen durch den Otto Brenner Preis als auch den Reporter:innenpreis bestärken diesen Eindruck nochmals. Das bestätigt Schweppe auch selbst: „Ich bin noch sehr lange auf den Text angesprochen worden. Und das freut mich natürlich – insbesondere, da das Risiko hoch und der Arbeitsaufwand enorm waren. Vor allem aber, weil dieses Thema für die Öffentlichkeit so wichtig ist.”
Mit der Veröffentlichung der Abschlussberichte der Enquete-Kommission und des Untersuchungsausschusses ist die parlamentarische Arbeit nach zweieinhalb Jahren nun zunächst abgeschlossen. Mit Blick auf die ausbleibenden politischen Konsequenzen verbleibt ein bitterer Beigeschmack: Während bis heute viele Ortskräfte in Afghanistan unter Lebensgefahr festsitzen – das Bundesaufnahmeprogramm nun sogar gestoppt wurde – sind beteiligte Spitzenbeamt*innen, wie Schweppe es ausdrückt, nach oben gefallen. Umso ernüchternder ist es, dass die Veröffentlichung und Ergebnisse der Abschlussberichte in der Aufregung um die vorgezogene Bundestagswahl 2025 nicht öffentlichkeitswirksam diskutiert wurden.
Doch Schweppe betont wiederholt die Notwendigkeit, sich nicht darauf zu versteifen, dass politische Konsequenzen ausblieben. „In den Medien neigen wir oft dazu zu glauben, dass Impact bedeutet, dass jemand zurücktreten muss. Das ist mir zu einfach. Wenn ein Thema ernsthaft diskutiert wird und eine Debatte anstößt – und das hat es hier – dann ist das für mich ein sehr wertvoller Impact.“