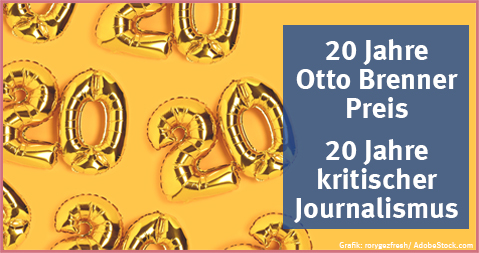Newcomerpreise 2024, 2021, 2012 und 2005
„Ich glaube, man müsste mehr zuhören“
Ein ganz frischer Brenner-Preisträger ist Manuel Biallas. 2024 wurde er mit dem Newcomer-Preis ausgezeichnet. Uns erzählte Manuel von seiner Recherche zu türkischem Nationalismus, sagt, worauf es für ihn bei der journalistischen Arbeit ankommt, und gibt Einblicke in seinen Weg in den Journalismus.
Von Amelie Gensel

Am Anfang stand eine Unterbelichtung. Manuel Biallas hatte das Gefühl, dass die Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023 von deutschen Medien zu wenig reflektiert wurde: „Ich wollte die Berichterstattung zu dem Ereignis untersuchen, das ein bisschen mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland betrifft.“ Deshalb hat er untersucht, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk über die Wahlen in der Türkei berichtet hatte und sogenannte Influencer identifiziert, die den in Deutschland lebenden Türk*innen nationalistische Inhalte vermitteln wollen. Resultat seiner Recherche war der im NDR-Medienmagazin ZAPP ausgestrahlte Film Erdogans Influencer: Wie sie rechte Propaganda verbreiten, der 2024 den Brenner-Newcomer-Preis erhielt.
Für seinen ZAPP-Film musste er Zugang zu türkischen Nationalisten finden. Aber waren die ohne Weiteres zum Interview mit einem deutschen Fernsehsender bereit? „Ich war gegenüber den Protagonisten ziemlich offen und habe gesagt, dass ich das schon kritisch sehe, was sie machen, aber dass ich auch weiß, aus welcher – in Anführungszeichen – Notwendigkeit heraus sie ihre Inhalte produzieren“, erklärt Biallas. Er betont: „Es war für mich die Maßgabe, wenn ich überhaupt einen Film dazu mache, dann will ich mit den Influencern reden und nicht über sie.“ Biallas stand bei seiner Recherche aber auch vor verschlossenen Türen in den Redaktionen: „Es war am Anfang relativ schwierig, dieses Thema überhaupt zu platzieren”, erinnert er sich. Dann habe er das Glück gehabt, dass es eine Redakteurin gab, die das Thema ebenfalls bedeutsam fand.
Manuel Biallas wurde 1996 in Saarbrücken geboren. Nach dem Abitur begann er ein Jurastudium. Zwei Semester reichten, um festzustellen, dass die Juristerei nicht zu ihm passt. Um dennoch „Gerechtigkeit in die Welt zu holen“, orientierte er sich um, machte einen Bachelor in Politikwissenschaft an der Universität Hamburg. „Während des Studiums habe ich ganz viel in der Gastronomie gearbeitet, damit ich mir Praktika leisten konnte“, berichtet Biallas. Einige journalistische Praktika waren „furchtbar langweilig“, ein Praktikum beim SWR kann er empfehlen: „Da darf man sehr viel selbst machen.“ Für das Volontariat beim NDR hat es erst im zweiten Anlauf geklappt. „Ich bin nicht sehr wohlhabend aufgewachsen und hatte wenig Chancen, in den Journalismus reinzukommen. Ich wusste auch lange Zeit gar nicht, was Journalismus ist”, erzählt Biallas. Mittlerweile hat er seinen Einstieg in den Journalismus geschafft und recherchiert zu Migrationsthemen, über die Türkei oder innenpolitische Themen.
Und was hat sich für den Newcomer verändert, seit er im vergangenen Jahr den Newcomer-Preis gewonnen hat? Dank des „hochkarätigen Preises” spürt der junge Journalist einen Vertrauensvorschuss. Außerdem wüssten jetzt andere Redaktionen: „Der hat doch irgendwie schon mal was zur Türkei gemacht.” Das sei wichtig für künftige Rechercheaufträge. Gerade ist Biallas mit seiner beruflichen Situation ziemlich zufrieden: „Ich kann in großen Teilen das machen, worauf ich Lust habe. Ich kann kritisch sein. Ich habe einen Chef, der mich schützt, wenn ich mich zu politischen Ereignissen äußere. Das ist wichtig.”
Was könnte seiner Meinung nach den Journalismus besser machen? „Ich glaube, man müsste mehr zuhören, mehr fragen, was draußen abgeht, mehr mit Leuten offen reden, ohne vorher eine Hypothese festgelegt zu haben.”
„Meine beste Recherchequelle war Instagram“
Selina Bettendorf hat schon früh angefangen, journalistisch zu schreiben. Nach mehreren Praktika folgte dann ein Volontariat beim Tagesspiegel in Berlin. Mittlerweile arbeitet sie als Redakteurin beim Dossier der Süddeutschen Zeitung im Themenbereich Digitalwende.
Von Julia Pulm

„Ich habe angefangen für eine Lokalzeitung zu schreiben, da ich dort ein Praktikum gemacht habe. Und dann habe ich einfach immer weitergeschrieben“, antwortet Selina Bettendorf auf die Frage nach ihrem Berufseinstieg. Ihren Weg in den Journalismus beschreibt sie selbst als „zufällig passiert“. So studierte sie unter anderem Medien, Ethik und Religion an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Es folgten weitere journalistische Praktika, ehe sie 2019 ein Volontariat beim Tagesspiegel begann. Dort stieß sie auf ein spezielles Recherchethema, das sie bis heute umtreibt: sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Die Idee kam in der Redaktion durch einen zuvor erschienenen Kurzfilm von Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Sophie Passmann mit dem Titel Männerwelten auf, erzählt sie. Jedoch wollte Bettendorf nicht nur Frauen und deren Erlebtes zu Wort kommen lassen, sondern den Blick auf Männer richten, die ihr eigenes Verhalten reflektieren – oder eben nicht. Der daraus entstandene Artikel Das Schweigen der Männer, erschienen im Berliner Tagesspiegel, wurde 2021 mit dem Otto Brenner Preis in der Kategorie Newcomer ausgezeichnet.
„Ich hätte diese Recherche nicht machen können, wenn mich das Thema nicht so stark interessiert hätte“, sagt Bettendorf. Denn die Suche nach Männern, die ihr Schweigen brechen wollten, war nicht gerade einfach. „Meine beste Recherchequelle bei dieser Suche war Instagram“, sagt die Journalistin. Auf dem Instagram-Profil des Tagesspiegel hatte sie einen Aufruf gestartet, auf den hin sich mehrere Männer meldeten. Weitere Interviewpartner fand sie über einen Aufruf im Newsletter der Zeitung und durch eine intensive Internetrecherche. Über ein halbes Jahr dauerte ihre aufwendige Recherche, bis ihr Artikel schließlich im Januar 2021 erschien.
Mittlerweile schreibt Selina Bettendorf schwerpunktmäßig über Cybersicherheit, Desinformation und Kritische Infrastruktur im Dossier der Süddeutschen Zeitung. An ihrem früheren Thema will sie dennoch dranbleiben. Denn sie findet, dass sexualisierter Gewalt gegen Frauen mehr Beachtung geschenkt werden müsse. Ein bisschen half dabei der Otto Brenner Preis. „Der Newcomer-Preis hat meinem Text und dem Thema zusätzliche Aufmerksamkeit eingebracht,“ sagt Bettendorf. Gleichzeitig empfand sie die Auszeichnung auch als Bestätigung ihres journalistischen Handwerks, weil ihr Artikel von der Jury, also externen Professionellen, für gut befunden wurde. „So ein renommierter Preis kann auch hilfreich sein bei neuen Projekten.“
Auf die Frage, wie sich der Journalismus seit ihrem Berufseinstieg verändert hat, antwortet Bettendorf kritisch: „Eigentlich spielen wir eine sehr relevante Rolle für die Demokratie.“ Mit „wir“ meint sie alle Journalist*innen. „Aber wenn alle Redaktionen sparen müssen, dann ist das ein Problem.“ Vom Printjournalismus wurde ihr früh abgeraten und auch heute höre sie oft nur pessimistische Stimmen, wenn es um die Finanzierung des Journalismus geht. Umso wichtiger sei es, dass Medienhäuser den digitalen Wandel mitgehen, findet Selina Bettendorf. Einige Medienmarken würden bereits viele gute Projekte in den sozialen Medien anbieten, was sie als „extrem wichtig” ansieht. Dieser Prozess hätte jedoch früher angestoßen werden müssen, lautet ihre Kritik. Auf den digitalen Wandel müsse mit kreativer Anpassung geantwortet werden.
Selina Bettendorf empfiehlt jungen Journalist*innen, sich nicht entmutigen zu lassen. Das gelte gerade für junge Frauen. Denn insbesondere der Politikjournalismus sei noch immer eine Männerwelt. „Aber auch dort gibt es mittlerweile weibliche Vorbilder – junge Frauen können das auch.“
„Wir müssen mit Rechten im Gespräch bleiben“
Anne Lena Mösken ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeitung Freie Presse in Chemnitz. Im Jahr 2012 wurde sie mit dem Otto Brenner Preis in der Kategorie Newcomer ausgezeichnet. Das Thema ihrer Recherche: Frauen in rechten Kreisen.
Von Julia Pulm

„Ich habe mich immer dafür interessiert, was Menschen in den Rechtsextremismus zieht“, sagt Anne Lena Mösken. Das war schon so bei dem Artikel Ihr Kampf, der 2012 im Magazin der Berliner Zeitung erschien und für den sie den Newcomer-Preis der Otto Brenner Stiftung erhalten hat. Nacherzählt wurde die Geschichte einer Frau, die auf der Suche nach ihrer politischen Identität in die NPD eingetreten war. „Damals entstand in der Redaktion die Idee, rechte Frauen in den Blick zu nehmen“, erinnert sich Mösken. Die Suche nach genau diesen Frauen habe sich jedoch schwierig gestaltet. „Ich habe tatsächlich teilweise an Haustüren geklingelt”, beschreibt sie ihre Recherche.
Irgendwann stieß Mösken auf eine Frau, über die damals ein großes Porträt in der Brigitte erschienen war, nachdem diese als NPD-Frau ihren Job verloren hatte. „Ich hatte das Gefühl, dass in diesem Artikel so viel offengeblieben ist,“ so Mösken. Aber wie kann man politisch weit rechts stehende Menschen für ein Interview gewinnen? „Ich habe ihr gesagt, dass ich diesen Artikel über sie kenne, aber noch einmal ihre Position hören möchte und wie es für sie weitergegangen ist.“ Dieses Interesse für die Person hinter ihrer Geschichte hat die Frau überzeugt. Mösken hat gemerkt, dass Menschen aus dem rechten Milieu gleichermaßen ein Bedürfnis haben, ihre Geschichten zu erzählen. Offen und sachlich in ein Gespräch zu gehen, das ist für die Journalistin ein Schlüssel in das Gespräch hinein, auch wenn sie die ideologischen Werte ihrer Interviewpartner*innen nicht teilt. Sie ist sich sicher: „Wir müssen mit Rechten im Gespräch bleiben, um zu verstehen, wie Gedankenwelten und Ideologien funktionieren.“
Die heutige stellvertretende Chefredakteurin hat bereits mehrere Journalismuspreise erhalten. Zuletzt den Deutschen Reporter:innen-Preis für die Lokalreportage Ein Leben für Großschirma. Auch in diesem Artikel spielt Rechtspopulismus eine Rolle. Darin werden die tragischen Umstände des Todes des früheren Bürgermeisters von Großschirma in Sachsen beleuchtet.
Bis Mösken ihren Weg in den Journalismus fand, dauerte es eine Zeit. Ihre ersten Schritte machte sie als Praktikantin beim Flensburger Tageblatt und schrieb dort vorwiegend Meldungen. „Da bin ich mit dem Gedanken rausgegangen, dass ich das auf keinen Fall machen will, weil es sehr kleinteilig war“, erzählt sie. Erst ein Reportagekurs von Ariel Hauptmeier im Rahmen ihres Studiums der Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin habe sie wieder wach gekitzelt. Darauf folgte ein Volontariat bei der Berliner Zeitung. Die Jury des Otto Brenner Preises entdeckte sie dann als journalistisches Talent.
„Der Otto Brenner Preis ist ein Preis, der einen Journalismus hochhält, den ich sehr bewundere. Es geht um Geschichten, die wirklich etwas verändern und einen Impact haben“, sagt Mösken. Für sie sei die Auszeichnung eine tolle Wertschätzung gewesen. Denn ausgezeichnet zu werden, stärke den Status in der Redaktion und auch die Möglichkeit, sich als Journalistin für andere Themen zu empfehlen. Dabei findet Mösken, dass man Journalismuspreise auch kritisch sehen darf. „Viele Kolleg*innen machen jeden Tag einen super Job, werden aber nie auf den Radar von Journalismuspreisen kommen, da ihre Arbeit zu kleinteilig oder letztlich zu alltäglich ist.“
Gerade den Lokaljournalismus hält die Journalistin für ein wichtiges Element innerhalb der Demokratie. Denn auch wenn das Vertrauen gegenüber den Medien eher abnehme, habe Lokaljournalismus die Chance, die Menschen im Gespräch zu halten, so Mösken. „Lokaljournalismus findet da statt, wo die Menschen sind: vor ihrer Haustür.”
Auf die Frage, was sie jungen Journalist*innen auf den Weg geben würde, sagt sie: „Ich wünsche mir, dass junge Journalist*innen mutig sind, auch solche Themen anzugehen, die unbequem sind.“
„Sich mit Journalismus die Welt erschließen“
Maximilian Popp ist Redakteur im SPIEGEL-Ressort Ausland. Zu Beginn seiner Karriere hat er den 2005 erstmals vergebenen Newcomer-Preis der Otto Brenner Stiftung gewonnen. Im Interview erzählt Popp über seine berufliche Laufbahn und warum Journalismus für ihn ein einzigartiger Beruf ist.
Von Amelie Gensel

Maximilian Popp, heute 39 Jahre alt, hat bereits zu seiner Schulzeit in Passau für die Schülerzeitung Rückenwind geschrieben. Für seinen dort veröffentlichten Artikel Passauer Neue Mitte wurde der Gymnasiast 2005 mit dem ersten Otto Brenner Newcomer-Preis ausgezeichnet. Thema war die umstrittene bauliche Neugestaltung der Innenstadt in Passau. „Das war ja so kurz bevor ich Abi gemacht habe, das war damals ein Riesenthema“, erinnert sich Popp.
Das städtebauliche Projekt wurde kritisiert, da durch den Bau eines Einkaufszentrums eine menschenleere Fußgängerzone befürchtet wurde. Popp erzählt, dass es bei der Entscheidung für das Einkaufszentrum ein aus seiner Sicht problematisches Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft gab. Es sei ein anschauliches Beispiel dafür gewesen, wie Kontrollmechanismen versagen.
Gleich nach dem Abitur besuchte Maximilian Popp schon mit 19 Jahren die renommierte Henri-Nannen-Schule für die Ausbildung von Journalist*innen in Hamburg. „Ich dachte, ich bewerbe mich halt mal und dann hat es geklappt und dann hat sich vieles daraus ergeben”, erinnert er sich. Nach seiner Zeit in Hamburg ging es für ihn in die türkische Hafenstadt Istanbul, für ein Politikstudium an der Bilgi University. „Aber da wusste ich eigentlich schon, dass ich Journalist werden will”, meint Popp. „Ich finde, Journalismus ist ein guter Weg, um sich die Welt zu erschließen, Dinge zu verstehen, Fragen stellen zu können und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und irgendwie zu begreifen, was da draußen passiert.” Das macht Popp seit 2010 beim SPIEGEL. Ab 2016 war er als Korrespondent in Istanbul und anschließend, ab 2019, für vier Jahre stellvertretender Ressortleiter im Ausland-Ressort. Seit 2023 ist er dort nun Reporter, er ist viel in der Welt unterwegs. Aktuell treiben Maximilian Popp die Entwicklung in Nahost um, immer noch die Türkei und der Rechtsruck in Europa. Gerade ist er aus einem Jahr Elternzeit zurück und freut sich auf seine journalistische Arbeit: „Das Schöne am Journalismus ist ja, dass man irgendwie nicht den Beruf wechseln muss oder noch nicht mal den Arbeitgeber – und trotzdem ist es super abwechslungsreich.”
Auf die Frage, inwiefern der Newcomer-Preis seine berufliche Laufbahn geprägt hat, meint Popp: „Ich bin sehr dankbar für den Preis. Wertschätzung für journalistische Arbeit ist erst mal immer gut und wichtig. Ich glaube aber nicht, dass es der Grund ist, warum wir die Arbeit machen.“ Für Maximilian Popp sind Auszeichnungen nie der Antrieb für seine Arbeit gewesen. Es sei vielmehr ein Beruf, den er gerne mache und der auch als Kontrollinstanz wichtig für eine funktionierende Demokratie sei.
Der Brenner-Preisträger 2005 hat jahrelang journalistische Erfahrungen sammeln können. Er verrät uns seinen Glaubenssatz: „Was die Regel Nummer eins ist: Einfach immer Journalismus zu machen, neugierig zu sein und verstehen zu wollen, was um einen herum passiert”.