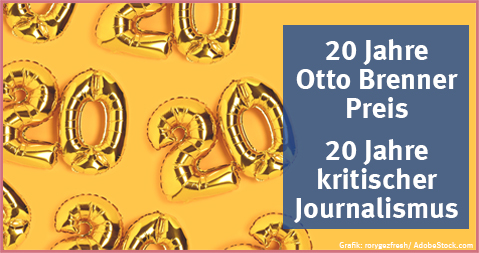Recherchestipendien des Otto Brenner Preises
Vor allem freie Journalist*innen brauchen Unterstützung
Seit 2005 vergibt die Otto Brenner Stiftung jährlich drei Recherchestipendien an Journalist*innen, die besonders gut ausgearbeitete Recherchekonzepte zu relevanten und aktuellen Themen vorgelegt haben. Jedes Projekt wird seither mit 5.000 Euro gefördert und von erfahrenen Mentor*innen begleitet.
Von Julia Pulm und Michelle Thome
Text als pdf-Download
Recherchieren kostet Zeit und Geld. Das gilt umso mehr, wenn Recherchen mit größeren Reisen oder komplexen Informationsanfragen verbunden sind. So wie bei der freien Journalistin und Filmemacherin Olivia Samnick und ihrer aus der Ukraine stammenden Recherchepartnerin Mariya Merkusheva. In einem Cross-Border-Team aus europäischen Journalistinnen recherchierten sie zur Ausbeutung geflüchteter Ukrainer*innen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Für ihre Recherche waren die beiden Journalistinnen in ganz Deutschland unterwegs, um Betroffene zu treffen. Reise- und Übernachtungskosten übersteigen dabei schnell die Honorare, die später für die Publikation gezahlt werden. Es sind Kosten, die insbesondere freie Journalist*innen belasten können. Mit einem Recherchestipendium der Otto Brenner Stiftung konnten Samnick und Merkusheva ihre Recherche gegenfinanzieren.
Solch ein Stipendium in Höhe von 5.000 Euro wird im Rahmen des Otto Brenner Preises an drei besonders überzeugende Recherchekonzepte jedes Jahr vergeben. Interessierte können sich bewerben, indem sie ein ausführliches Exposé mit Recherchekonzept sowie Zeit- und Kostenplan einreichen.
Weltweit unterstützen Stiftungen und gemeinnützige Organisationen journalistische Recherchen mit einem Stipendium. Gelder und Vergabekriterien variieren jedoch. Manche Stiftungen loben explizit Reisestipendien aus, andere Recherchestipendien sind auf bestimmte Ressorts ausgerichtet. Doch wie geeignet sind Recherchestipendien als Fördermittel? Olivia Samnick, Tim Kalvelage, Benedict Wermter und Katrin Blum berichten über ihre Erfahrungen als Stipendiat*innen der Otto Brenner Stiftung.
Aufwendige Recherchereisen
Tim Kalvelage hat bereits mehrere Recherchestipendien erhalten. Er ist freier Wissenschaftsjournalist und promovierte in der Abteilung Biogeochemie am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen. „Als Wissenschaftsjournalist ist man schnell drei, vier, manchmal sogar acht Wochen unterwegs“, sagt Kalvelage. Er erhielt 2022 ein Recherchestipendium der Otto Brenner Stiftung und recherchierte zu den Umweltschäden durch Tiefseebergbau. Dazu flog er zunächst nach San Diego, um dann mit einem Forschungsteam per Schiff in den Nordostpazifik aufzubrechen. „Das sind Recherchen, die man nur schwer umsetzen kann, da nur wenige Medien das Geld dafür haben“, so Kalvelage. Er hat sich auf Themen rund um Ozean- und Polarforschung spezialisiert. Im Journalismus bedient er damit ein Nischenthema. Das schränkt ihn bei der Auswahl der Recherchestipendien ein. „Es gibt viele klassische Stipendien zu gesellschaftlichen und sozialen Themen. Da bin ich dann leider raus. Ich suche also meistens nach Stipendien im Bereich Wissenschaft und Umwelt.”
Als Vergabekriterien schreibt die Otto Brenner Stiftung vor, dass sich Recherchen kritisch mit gesellschaftlich relevanten Themen befassen und den Schwerpunkten der Stiftung – darunter Medienpolitik, Zivilgesellschaft und Demokratie, Gewerkschaften, Arbeit und Globalisierung – zuzuordnen sein sollen. Weiter heißt es auf der Webseite der Stiftung, dass „gesellschaftlich relevante, aber gemessen an deren Bedeutung nicht ausreichend behandelte Themen in das Blickfeld der Öffentlichkeit“ gerückt werden sollen.
Welche Recherchethemen gefördert werden, entscheidet eine siebenköpfige Jury. Mit Blick auf Kalvelages Recherche erklärt Jurymitglied Volker Lilienthal, dass die Jury kritisch prüfe, „ob jemand nur mal seine Reisen in ferne Länder finanziert haben möchte“. Solche sogenannten Reisestipendien würden in der Regel nicht gewährt. Bei Kalvelage aber sei das anders gewesen. Die Jury erkannte einen inhaltlich notwendigen Reiseaufwand.
Bereits dreimal hat Wissenschaftsjournalist Kalvelage ein Stipendium der Europäischen Geowissenschaftlichen Union erhalten sowie einmal das der Wissenschaftspressekonferenz. Für viele andere klassische, investigative Recherchestipendien ist er zuvor abgelehnt worden. Umso überraschender fand er es, die Förderung durch die Otto Brenner Stiftung zu erhalten. „Häufig bekommt man eine Absage mit der Begründung, dass das Thema zu wenig investigativ sei“, so Kalvelage.
Auch Benedict Wermter bearbeitete ein Nischenthema. Als freier Journalist recherchierte er zu politischen Machenschaften in der Abfallwirtschaft. Mittlerweile hat er eine eigene Stiftung für Umweltbildung in Indonesien gegründet und betreibt dort auch eine Videoproduktionsfirma. In seiner Rolle als Key Opinion Leader in den Sozialen Medien nutzt er sein Fachwissen, um den öffentlichen Diskurs in Indonesien zum Thema Plastikmüll aktiv zu gestalten, anstatt ausschließlich darüber zu berichten.
Im Jahr 2020 hat er sich erfolgreich um das Recherchestipendium der Otto Brenner Stiftung beworben. Gemeinsam mit Michael Billig ging er der Müllverbrennung in Zementfabriken auf die Spur. „Es ist ein sehr nerdiges Thema, das erstmal kein Mensch auf dem Schirm hat und versteht. Das aber alle betrifft. Aber genau deswegen passt es so gut“, sagt Wermter. Insbesondere vermeintliche Nischenthemen können durch Recherchestipendien von einer zusätzlichen Aufmerksamkeit profitieren. Der Output ihrer Recherche hätte sich ohne Stipendium womöglich anders gestaltet, vermutet Wermter: „Wir hätten sicher etwas thematisch in die Richtung gemacht, aber es hätte wahrscheinlich nicht dieselbe Relevanz gehabt.“
Mehr als eine Finanzspritze
Mit Blick auf die Stipendiat*innen der letzten Jahre fällt eines auf: Ein großer Teil arbeitet vorwiegend als freie Journalistin oder freier Journalist. Die Vergabe von Recherchestipendien weist damit auf ein strukturelles Problem im Journalismus hin. Recherchen werden immer teurer, die Budgets der Medienhäuser für freie Langzeitrecherchen bleiben jedoch knapp bemessen. Freie Journalist*innen werden vor finanzielle Herausforderungen gestellt, wenn Recherchekosten nicht entsprechend gegenfinanziert werden. „Recherchestipendien sind kein ‚nice to have‘, sondern oft ein ‚must have‘,“ sagt Olivia Samnick, deren gemeinsame Recherche mit Mariya Merkusheva nicht unerhebliche Reisekosten mit sich brachte. „Wenn sich an der Finanzierungsstruktur im Journalismus nichts ändert, bleibt die Abhängigkeit von Grants und Stipendien aller Art bestehen.”
Ähnlich sieht das auch Benedict Wermter. Vor allem freie Journalist*innen würden oft aufwendige und investigative Inhalte recherchieren, die seltener an die Festangestellten eines Medienhauses vergeben werden. Das gelte insbesondere für Geschehnisse außerhalb der Tagesordnung. „Die Themen, die die letzten Jahre durch die Otto Brenner Stiftung gefördert wurden, sind solche, die sonst kaum jemand anpackt“, so Wermter.
Aber welche Kosten lassen sich nun mit einem Recherchestipendium decken? „Wir konnten im Wesentlichen unsere Reisekosten – wie Bahntickets und Übernachtungskosten – abdecken“, berichtet Olivia Samnick. Auch Kosten zur Informationsbeschaffung könnten mit einem Recherchestipendium abgegolten werden, darunter Anträge auf Informationszugang bei verschiedenen Stellen des Bundes. „Die Otto Brenner Stiftung vergibt einen hohen Betrag, aber der ist dann doch schnell weg. Erstens, wenn man zu zweit ist und zweitens, wenn man über einen langen Zeitraum recherchiert“, sagt Samnick. Für diese Recherche erhielten sie und Recherchepartnerin Merkusheva noch eine zweite Förderung durch die International Women’s Media Foundation. Ein klassisches Gehalt für den entstandenen Arbeits- und Zeitaufwand umfasst ein Stipendium jedoch nicht – insbesondere, wenn man zu zweit recherchiert und das Geld aufteilen muss. „Wenn man das gegenrechnen würde, hätten wir einen sehr geringen Stundenlohn gehabt“, betont Samnick.
Ausgelobte Stipendien zielen also darauf ab, Recherchen finanziell zu unterstützen und strukturelle Kosten zu kompensieren. Welche Kosten tatsächlich abgedeckt werden können, ist von der Komplexität der Recherche abhängig. Gerade der finanzielle Rechercheaufwand kann durchaus etwas höher ausfallen als anfangs kalkuliert, wie Samnick betont: „Letztendlich können immer unvorhersehbare Dinge passieren, weshalb man dann doch Mehrkosten hat.” Umso wichtiger ist es, Recherchen in mehreren Beiträgen und für verschiedene Medienhäuser aufzubereiten. Tim Kalvelage konnte seine Recherche zum Tiefseebergbau in gleich drei Medien veröffentlichen. „Wenn man drei bis vier Monate investiert, dann muss man die Geschichte mehrfach verkaufen, sonst rechnet sich das nicht“, sagt er.
Ein Recherchestipendium bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Zugang zu einem starken Netzwerk aus erfahrenen Journalist*innen, die den Stipendiat*innen als Mentor*innen zur Seite gestellt werden. Dieses Mentoring sieht dabei keine festgelegten Jour Fixes und Recherche-Updates vor, sondern ist vielmehr als lockeres Format eines ungezwungenen Austausches zu verstehen. „So haben wir uns das im Mentoring auch gewünscht, dass wir auf ihn zugehen, wenn wir Fragen, Wünsche und Anregungen haben“, sagt Samnick, deren Mentor Jurymitglied Harald Schumann war. „Man bekommt einen Mentor zur Seite gestellt, der wahnsinnig viel Expertise mitbringt und auf über zwanzig Jahre Erfahrung im Journalismus zurückblickt, die man selbst als Stipendiatin vielleicht gar nicht hat.“
Nicht jede Recherche gelingt
Katrin Blum hat im Jahr 2007 ein Stipendium der Otto Brenner Stiftung erhalten. Für ihre Recherche stellte sie sich die anspruchsvolle Frage: „Was kostet das Leben – oder sind wir vor dem Tod wirklich alle gleich?“ Damals arbeitete sie als freie Journalistin, nachdem sie erfolgreich die Deutsche Journalistenschule in München besucht hatte. Ihre Recherche verlief jedoch nur mühsam. „Es war ein wahnsinniger Druck, weil meine Recherche nicht funktioniert hat“, erinnert sich Blum. Für diese wollte sie herausfinden, inwiefern Geld über Leben und Tod entscheidet – vor dem Hintergrund, dass Krankenversicherte immer häufiger medizinische Behandlungen selbst zahlen müssen und sich eine Zweiklassengesellschaft verfestigt habe. Blum wollte ihre Reportage anhand persönlicher Geschichten von Betroffenen erzählen. Die Suche nach diesen gestaltete sich jedoch sehr schwierig bis aussichtslos, sodass sie ihre Recherche letztlich abbrechen musste. „Es wäre besser gewesen, ein Thema zu pitchen, für das man vorher schon passende Protagonisten gehabt hätte“, sagt sie heute.
Dennoch hält sie Recherchestipendien für wichtig. Denn die Honorare von Medienhäusern für freie Recherchen seien noch immer „unterirdisch“, sodass Recherchestipendien finanzielle Freiheiten schaffen können. Auch brächten sie ein gewisses ‚Standing‘ mit sich: „Es ist ähnlich wie mit einem Preis. Wenn man ein Recherchestipendium gewonnen hat, kann man sich das auf die Visitenkarte schreiben.“
Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Tim Kalvelage. Ein Recherchestipendium sorge für mehr Sichtbarkeit innerhalb journalistischer Kreise. „Stipendien sind ein berufliches Renommee in den Kreisen, in denen man sich bewegt“, sagt er.
Außerdem kann ein Stipendium für Honorarverhandlungen mit Medienhäusern hilfreich sein. So zeige es, „dass es da eine Institution gibt, die die Recherche-Idee für so stark hält, dass sie schon darin investiert, bevor die Recherche überhaupt angefangen hat”, sagt Olivia Samnick. Das könne die eigene Position gegenüber einer Redaktion stärken.
Rechercheaufwand durch höhere Honorare würdigen
Ein Punkt wurde in allen vier Gesprächen deutlich: Recherchestipendien sind insbesondere für freie Journalist*innen wichtig. Benedict Wermter sieht daher auch die Stipendien vergebenden Institutionen in der Verantwortung und findet, dass sich diese bei der Vergabe vor allem auf freie Journalist*innen konzentrieren sollten, anstatt sie an Festangestellte in größeren Medienhäusern zu vergeben. „Medienhäuser, die profitorientiert sind und auf verschiedenste Weisen Einnahmen erzielen können, sollten doch eigentlich ihre Recherchen selbst bezahlen”, findet er. Dem stimmt Jurymitglied Volker Lilienthal zu. Er weist darauf hin, dass Festangestellte in Verlagen oder auch im gut ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Regel keine Chance auf ein Stipendium der Otto Brenner Stiftung hätten. Da seien schon deren Arbeitgeber in der Pflicht, so Lilienthal.
Wermter übt aber auch Kritik an der Höhe der Förderung und findet ein Preisgeld von 5.000 Euro für heutige wirtschaftliche Verhältnisse nicht mehr ganz angemessen. Dies treffe auch auf die Honorare der Medienhäuser für die Artikel der freien Journalist*innen zu, findet Samnick: „Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Medienhäuser, die die Beiträge letztlich veröffentlichen, nicht nur die moralisch-ethische Wertschätzung mitbringen, sondern eben auch die finanzielle, indem sie Beiträge, die sie einkaufen, fair entlohnen.”
Ohne das Stipendium wären die Recherchen von Benedict Wermter und Olivia Samnick komprimierter ausgefallen. Samnick und ihre Kollegin Merkusheva hätten sich zeitlich sowie räumlich begrenzen müssen, um Anfahrts- und Übernachtungskosten zu sparen. Auch Benedict Wermter gibt zu bedenken, dass er und sein Recherchepartner Michael Billig für ihre Recherche weniger Zeit hätten ansetzen können, wenn ihnen kein Recherchestipendium zur Verfügung gestanden hätte. Das Recherchestipendium habe ihn hingegen dazu verleitet, an dem Thema Plastikmüll dranzubleiben. Und das sehr erfolgreich. Mit dem Dokumentarfilm Die Recyclinglüge gewannen er und Co-Autor Tom Costello dann im Jahr 2022 noch den dritten Platz in der Kategorie ‚Allgemein‘ des Otto Brenner Preises.
Lohnen sich Recherchestipendien denn nun auch wirklich? Bei dieser Frage sind sich alle vier Stipendiat*innen einig und die kurze Antwort lautet: Ja. Denn viele Geschichten blieben ohne adäquate Förderung unerzählt. „Ich bin eine große Verfechterin von Recherchestipendien”, resümiert Olivia Samnick. „Gerade im freien, investigativen Journalismus sind sie essenziell, da die Recherchen oft viel Zeit in Anspruch nehmen und komplex sind.”