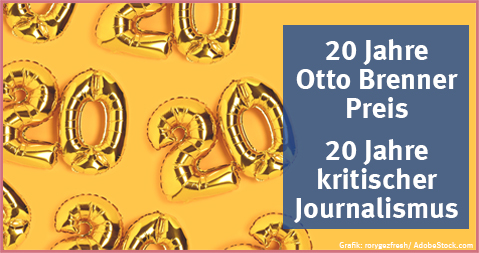Welches Renommee, welche Effekte hat der Otto Brenner Preis?
Eine Umfrage unter Preisträger*innen und Stipendiat*innen aus 20 Jahren
„Für große Mainstream-Medien ist der OBP nicht der wichtigste Preis. Da zählen andere, die mehr Wert auf schönes Schreiben oder große Skandale legen“, meinte in unserer anonymen Online-Umfrage ein*e Preisträger*in, den*die wir „Nr. 11“ nennen wollen. Das hört sich so an, als würde hier ein namhafter Journalismuspreis in seiner Bedeutung tiefergehängt. Aber die Aussage von Nr. 11 geht ja weiter: „Aber dass der OBP anders ist, macht ihn gerade so wertvoll. Bitte nicht den großen Trends hinterherlaufen – sondern unbequem bleiben und weiter unbequeme Kolleginnen und Kollegen prämieren.“
Ein Plädoyer also, das Ansporn sein kann für eine Weiterentwicklung des Wettbewerbs, den die Otto Brenner Stiftung alljährlich ausrichtet. In unserem Forschungsprojekt zum Otto Brenner Preis wollten wir nicht nur die aktuellen Auszeichnungen des 20. Jahrgangs vorstellen, die Motivationen der Preisträger*innen und ihre Recherchewege kennenlernen. Unser Ehrgeiz war es auch zu erfahren, wie Preisträger*innen, die vielleicht schon vor vielen Jahren ausgezeichnet wurden, heute auf den Moment der Ehrung zurückblicken.
Zur Methodik
Mittels einer anonymen Umfrage haben wir versucht, eine andere Untersuchung, die es schon zum Grimme Online Award (GOA) gegeben hat, zu replizieren (Gerlach et al. 2024; siehe Literatur). Denn über Journalismuspreise, ihr Zustandekommen und ihre Rezeption, ist in der Kommunikationswissenschaft wenig bekannt. Eine zweite Studie zu haben, die sich an eine vorhergehende anlehnt, hätte großen Erkenntnisgewinn versprochen, gerade auch in vergleichender Perspektive. Das Forschendenteam von der FU Berlin, das zum GOA geforscht hatte, stimmte unserer Replikation zu. Da der GOA nur Online-Veröffentlichungen auszeichnet, der Brenner-Preis aber ein Multi-Media-Wettbewerb einschließlich von Presse, Fernsehen und Hörfunk ist, haben wir die Fragenbatterie leicht angepasst. Die Umfrage wurde mit LimeSurvey programmiert.
In unserem Namen verschickte dann die Otto Brenner Stiftung den Umfrage-Link an 275 ehemalige Preisträger*innen, verbunden mit der Bitte, sich zu beteiligen. Wir kannten und kennen die dabei benutzten E-Mail-Adressen nicht, die Anonymität war auch insofern vollauf gewährleistet. Die Grundgesamtheit ist also N=275. Wir erhielten einen Rücklauf von 61 vollständig beantworteten Fragebögen. Das entspricht einem Rücklauf von 22 Prozent.
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse unserer Studie sollten vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass die Rücklaufquote unserer Befragung recht gering ausgefallen ist. In der gängigen Literatur wird der Rücklauf bei Online-Umfragen zwischen 20 und 40 Prozent benannt (Pedersen & Nielsen 2016, S. 233). Damit liegt unsere Rücklaufquote zwar noch in einem angemessenen Rahmen, fällt jedoch wesentlich schlechter aus im Vergleich zur Umfrage zum GOA (N=144, 68 auswertbare Fragebögen, Rücklaufquote 47 Prozent).
Im Fall unserer Umfrage kommt hinzu: Aus den einzelnen Wettbewerbssparten sind Befragte, die ein Recherchestipendium erhalten haben, überrepräsentiert. Sie machen rund 29,5 Prozent unserer Stichprobe aus. Befragte, die den Otto Brenner Preis in den eigentlichen Preissparten gewonnen haben, sind weniger stark vertreten. Den geringsten Anteil machen Befragte der Kategorie „Newcomer” (8,2 %) und „Besondere Auszeichnung” (9,8 %) aus.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, nur die Freitextantworten auszuwerten, nicht aber die sonstigen Daten, die für eine statistische Analyse wenig brauchbar erschienen. Die Mühe derjenigen, die unseren Online-Fragebogen gewissenhaft ausgefüllt haben, soll aber eben nicht vergeblich gewesen sein. Die von ihnen gegebenen qualitativen Antworten sollen im Folgenden synoptisch ausgewertet werden – immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sie nicht repräsentativ sein können für die große Gruppe von fast 300 ausgezeichneten Journalist*innen aus 20 Jahren.
„Dranbleiben an Dauerbrenner-Themen“
Gefragt hatten wir zum Beispiel nach typischen Qualitätsmerkmalen, wie sie journalistischen Produkten üblicherweise zugeordnet werden und deren Einlösung ein Marker für Preiswürdigkeit sein kann. Die Häufigkeiten, mit der einzelne Merkmale Zustimmung fanden oder eben nicht, lassen sich seriös, wie oben dargelegt, hier nicht darstellen. Interessant war aber, dass in den Freitextantworten andere Qualitätsmerkmale genannt wurden, die gerade auch in der wissenschaftlichen Qualitätsforschung weniger stark beachtet werden. Ein Beispiel ist „latente Aktualität“ (Preisträger*in Nr. 7; Hinweis: auch diese Ziffern erlauben keinen Rückschluss auf die Identität der Antwortenden. Wird eine Ziffer mehrfach genannt, muss das – technisch bedingt – nicht bedeuten, dass es sich um dieselbe Person handelt).
Der Preisträger*in Nr. 3 war Kontinuität in der journalistischen Berichterstattung besonders wichtig: „Dranbleiben an Dauerbrenner-Themen“, wie diese Person es formulierte. Nr. 15 überraschte uns mit der Nennung von „Humor“ – einem sehr menschlichen, oft aber rar gesäten Talent, wie man es normalerweise nicht ohne Weiteres mit Journalismus verbindet. Wiederkehrend wurde aber auch Originalität genannt, also eine Qualität, die man so verstehen könnte, dass der preisgekrönte Beitrag nicht nur wiederkehrende Berichterstattung und bekanntes Wissen über chronische Themen und Probleme reproduziert. Zitat von Nr. 17: „Es kann auch einfach die eine Geschichte sein, mit der niemand gerechnet hat.“
Das Renommee des Otto Brenner Preises wird durchgängig anerkannt: „Branchenbekannter, renommierter Preis“ (Nr. 58); „Renommierter wichtiger Preis“, (Nr. 7), „Bekannter und anerkannter Medienpreis“ (Nr. 10); „Guter Preis, gute Kriterien“ – so die Sichtweise von Nr. 17.
Nun gibt es in Deutschland sehr viele Journalist*innenpreise – annähernd 500 sollen es sein. Alle Preisausrichter kämpfen um Aufmerksamkeit, verfolgen aber nicht selten auch eigene Interessen. Nr. 3 hat dafür einen klaren Blick: „Mit Preisen adeln sich oft die Preisverleiher. Neben den anerkannten Preisen (zu denen auch [Brenner] gehört) gibt es inzwischen eine bedenkliche Zahl an Preisen, die sich Verbandsinteressen oder kommerziellen Interessen unterordnen. Oftmals sind diese hochdotiert.“ Nr. 6 stimmt zu: „Viele Preise sind sehr affirmativ. Ihre Jurys sind – vor allem bei Preisen für Wirtschaftsthemen – mit Leuten besetzt, die marktliberal denken und ökologische oder soziale Themen eher aussortieren. Das ist beim OBP anders, dankenswerterweise. Und ja, viele Preise sind interessengeleitet – manche möchte man gar nicht gewinnen.“
Auch der Grimme Online Award, der seit 2001 vergeben wird, in der Szene des Online-Journalismus großes Ansehen genießt und wie gesagt schon wissenschaftlich untersucht wurde, wurde von Nr. 8 etwas skeptisch beäugt: „Beim Grimme Online Award können Angebote selbst vorgeschlagen werden. Immer wieder ist zu beobachten, dass die Community […], die sich für den Preis interessier[t], [auf Kanälen] dazu aufgerufen wird, das betreffende Angebot für den Preis vorzuschlagen. Durch ein solches Vorschlagsverfahren kann schnell der Eindruck entstehen, dass populäre Angebote, die entsprechend häufig vorgeschlagen werden, besonders dringend nominiert werden müssen. Popularität bedeutet aber nicht zwangsweise auch Qualität. So entsteht beim GOA (und bei anderen Preisen mit einem ähnlichen Vorschlagsverfahren) von Anfang an eine Verzerrung.“
An „Grimme“, den berühmten, seit 1964 vergebenen Fernsehpreis, dachte auch Nr. 20 und äußerte den – erst noch zu verifizierenden – Verdacht, dass hier über die Jahre immer mal wieder Beiträge von „Hierarchien“ aus den Sendeanstalten „über informelle Kanäle lanciert“ worden seien, in Einzelfällen sogar nachnominiert, die sich dann „völlig überraschend“ im Wettbewerb durchgesetzt hätten. Das Fazit von Nr. 20 hebt kritisch ab auf die Macht von Netzwerken in Medienbranche und journalistischer Profession, auf privilegierende beziehungsweise diskriminierende Insider/Outsider-Konstellationen: „Insgesamt ist es für nicht in der Szene gut vernetzte Autoren deutlich schwieriger, zum Zuge zu kommen, gute Beziehungen sind leider äußerst wichtig.“
„Es fällt viel Gutes durchs Raster“
Wie kann man es besser machen? Beim Deutschen Reporter*innenpreis bekommen die Juror*innen die eingereichten Texte anonymisiert zu lesen, um nicht vom Namen des oder der Bewerber*in oder der einreichenden Redaktion positiv oder negativ beeinflusst zu werden. Aber ob das funktioniert? Nr. 12 hat da Zweifel: „Es herrscht ein klarer Bias in Richtung der großen Magazine und Wochenzeitungen und deren Hausstil. Man erkennt eine ZEIT Dossier-Geschichte schon am Ton, ebenso eine SPIEGEL Reporter-Geschichte, also ist selbst Anonymität wie beim Deutschen Reporterpreis nicht wirklich anonym.“
Ein Grundproblem aller Journalismus-Wettbewerbe spricht Nr. 19 an: „Preise können nur das bewerten, was eingereicht wird – es fällt viel Gutes durchs Raster.“
Woher kennen Sie den Otto Brenner Preis? wollten wir auch wissen. Die meisten Antworten benannten die erwartbaren Quellen: Bekanntmachung der Stiftung, nachfolgende Berichterstattung, Kolleg*innen, die diesen Wettbewerb empfahlen, Redaktionen, in denen zur Bewerbung aufgerufen wurde: „Mein Arbeitgeber weist regelmäßig auf Preise hin“ (Nr. 14). Manche recherchieren auch für sie passende Wettbewerbe (Nr. 25) und kommen so auf die Website journalistenpreise.de. Sehr entschieden äußert Nr. 52: „Den OBP kennt man einfach, wenn man im seriösen Journalismus arbeitet.“ Nr. 58 wurde von der Auszeichnung offenbar überrascht und hatte sich nicht selbst beworben (auch das kommt vor): „Ich war immer mehr mit meiner Arbeit beschäftigt, als mich um Preise zu kümmern.“ Mit Blick auf den gewerkschaftlichen Hintergrund der Otto Brenner Stiftung ist auch die Antwort von Nr. 6 interessant. Offenbar ebenfalls von der Auszeichnung überrascht, lernte er*sie die ganze Unternehmung erst anlässlich der Preisverleihung kennen. Nur der Name Otto Brenner, des „legendären IG Metall-Chefs“, war zuvor bekannt: „Mein Vater war Arbeiter und erst durch die Kampagne der Willy-Brandt-SPD – Aufstieg durch Bildung – war es meinem Bruder und mir möglich, Abitur zu machen und ein Hochschulstudium abzulegen.“
„Sie haben uns tollerweise entdeckt“
Was waren besondere Motive, sich um einen Otto Brenner Preis zu bewerben? Die verbreitete Wahrnehmung des während 20 Jahren erarbeiteten großen Ansehens dieses Wettbewerbs wurde oben schon zitiert.Einen Brenner-Preis zu erhalten, verspricht also Distinktionsgewinn, um es mit Pierre Bourdieu zu sagen. Doch es gibt noch andere wichtige Aspekte.
Sechsmal wurde die Passung des Brenner-Preises zur eigenen journalistischen Arbeit hervorgehoben: „Thema war passend“ (Nr. 20); „Das Thema passte, der prämierte Text kritisierte ein politisches Vorhaben auf sehr fundierte Weise – weil es schlimme ökologische und soziale Folgen gehabt hätte“ (Nr. 21); „Beitrag passte zu Kriterien“ (Nr. 22); „weil wir ihn für relevant und passend für unsere Formate hielten“ (Nr. 34); „,Kritischer Journalismus‘ passte“ (Nr. 60). Und schließlich Nr. 37 – hat sich beworben, „weil ich dachte, dass wir es mit einem besonderen Thema zu tun haben, das enorme gesellschaftliche Auswirkungen hat, und unsere Arbeit den möglichen Auswahlkriterien des OBP entsprechen könnte“. Aber auch in diesem Fall kam die Auszeichnung „vollkommen überraschend“. Ebenso hier, bei Nr. 45: „Ich habe mich nicht beworben. Sie haben uns tollerweise entdeckt.“
Was bei der Frage nach den Motiven, sich zu bewerben, aber auch mehrfach aufschien, war das – sehr legitime – wirtschaftliche Interesse: „Benötigte Finanzierung für ein Rechercheprojekt“ (Nr. 11); „Geldbedarf für aufwändige Recherche“ (Nr. 42). Hinter diesen beiden Antworten stecken sehr wahrscheinlich nicht Preisträger*innen im engeren Sinne, sondern Personen, denen ein Recherchestipendium zuerkannt wurde. In der Antwort von Nr. 3 ist das ganz eindeutig: „Ich konnte vor allem die Recherchen finanzieren – sie hätte es sonst nicht gegeben.“ Nr. 18 konnte ein Recherchevorhaben umsetzen, „das ich anders nicht hätte finanzieren können“; ebenso Nr. 17, eine Person, die nach eigener Auskunft dank des stipendienfinanzierten Rechercheerfolgs sogar in eine Festanstellung kam.
Nr. 44 erklärt: „Ich habe das Recherchestipendium bekommen (…): Ich wollte eine teure Geschichte recherchieren. In Deutschland gibt es viel zu wenige Stipendien im Stile von Journalismfund.eu, IJ4EU oder Pulitzer Center. Das OBS-Recherchestipendium bietet eine[s] der wenigen davon an.“ Nr. 5 weist auf die pekuniäre Prekarität in der Medienbranche hin, insbesondere bei freien Journalist*innen, und stellt Stipendien in ihrer Bedeutung sogar über Auszeichnungen für schon Publiziertes: „Angesichts der finanziellen Lage sind aus meiner Sicht Recherchestipendien deutlich wichtiger als Preise.“
Nr. 19 hebt, wie viele andere, die finanzielle Ermöglichung eines „aufwendigen Rechercheprojekts“ hervor. Über das Geld hinaus sollte man aber die persönlichen Erlebnisse eines psychologischen Empowerments bei Stipendiat*innen und überhaupt bei jungen Journalist*innen, die in der Sparte Newcomer ausgezeichnet wurden, nicht unterschätzen. Paradigmatisch kommt das bei Nr. 16 zum Ausdruck: „Ich war mir vor dem Stipendium unsicher, ob ich tiefe Recherchen schaffe. Diese Unsicherheit ist dank des Stipendiums verschwunden.“
Recherchestipendien können einen Experimentalraum eröffnen, der sonst so nicht möglich wäre, hebt Nr. 7 hervor: „Ich habe das Recherchestipendium genutzt, um eine tiefe, mehrere Monate dauernde Recherche auszuprobieren. Besonders wichtig war für mich die Verbindlichkeit: Ich musste die Recherche auch in schwierigen Phasen weiterführen, weil meine Kollegin und ich ja das Stipendium bekommen hatten. Dank dieser Erfahrung hatte ich das Vertrauen in mich selbst, weitere tiefe Recherchen anzugehen. Inzwischen mache ich fast ausschließlich tiefe Recherchen.“
Das Brenner-Stipendium war in diesem Fall also eine Ermutigung mit Langfristeffekt. Aber natürlich kann auch von den von der Brenner-Stiftung gezahlten Preisgeldern (insgesamt 47.000 Euro) angenommen werden, dass sie eine Gratifikation mit dem Effekt einer Motivation des Höher und Weiter darstellen und wohl gerade auch von freien Journalist*innen häufig in die Fortsetzung der eigenen journalistischen Arbeit reinvestiert werden. Nr. 8, freie*r Journalist*in, bringt es auf den Punkt: „Was der Preis mir genützt hat: Ich habe allein mit der Recherche und den vielen Veröffentlichungen, die daraus resultierten, fast ein halbes Jahreseinkommen verdient. Zudem konnte ich neue Auftraggeber erreichen, mit denen ich bis heute zusammenarbeite.“ So auch die Erfahrung von Nr. 25: „Neue Auftraggeber, mehr Vertrauensvorschuss von neuen Auftraggebern, Legitimierung als ,Preisträger‘ hilft bei Pitches.“
Der Preis ist politisch: ein „Schutzschirm“
Welche positiven Auswirkungen haben die Preisträger*innen oder Stipendiat*innen sonst noch für sich festgestellt? Ist es mehr als „Geld, gute Laune, Anerkennung, neue Kontakte“, wie Nr. 28 zusammenfasst? Einige der Antworten zu dieser Frage deuten auf eine politische Funktion zur internen Stützung journalistischer Arbeit hin: „Mir wurde nach Erhalt des OBP mehr zugetraut“, erinnert sich Nr. 1. Es sei leichter geworden, „im eigenen Haus für schwergängige Themen zu kämpfen“, bilanziert Nr. 4. Und Nr. 9 ergänzt: „Wir wurden ernster genommen und durften gleich die nächsten Filme machen. Insofern ist der Preis politisch.“ Größere Akzeptanz der eigenen Person innerhalb der redaktionellen Hierarchie kann die Folge sein, so Nr. 31: „Es war eine enorme Ermutigung und große Freude zu sehen, dass meine Arbeit insgesamt bemerkt wird. Das hat in den Kollegenkreis und die Branche ausgestrahlt, ist auch wichtig gegenüber Vorgesetzten.“ Nr. 4 sagt es noch genauer: „Ein anerkannter Preis wie der OBP spannt in gewisser Hinsicht einen Schutzschirm über die Redaktion und verschafft für eine gewisse Zeit Ruhe und Freiraum.“
Nr. 10 fühlte sich nach der Auszeichnung von ihren potenziellen Informant*innen ernster genommen: „Durch die Öffentlichkeit, die rund um Preise bezüglich des Themas hergestellt wurde, wurde ich als Expertin für das Thema der Recherche bekannter und bekam dadurch mehr Hinweise von Quellen.“ Ähnlich Nr. 13: „Initiativmeldungen von Informant*innen“. Noch etwas konkreter wird Nr. 49: „Größtenteils sind Preise eine brancheninterne Sache, aber ich habe (…) beobachtet, dass es Quellen gab, die durch die generelle größere Aufmerksamkeit für das Thema leichter den Kontakt zu mir gefunden haben.“
Einen etwas bitteren Beigeschmack hat aber die Antwort von Nr. 14: „Manche Kolleg*innen und Vorgesetzte sind beeindruckt und wollen mit mir zusammenarbeiten. Mir wurde allerdings auch in der Coronazeit ein Job gekündigt (wegen Einsparungen und weil ich als Letzte eingestellt wurde) mit der Begründung ,Da du einen Preis gewonnen hast, ist [es] doch ein Leichtes für dich, einen neuen Job zu finden‘." Als problematisch ist auch diese Reaktionsweise einer ungenannten Redaktion zu werten: „Förderung durch OBS sollte erst ,wegen Compliance‘ nicht bekanntgegeben, sondern verschwiegen werden. Nach mehreren Telefonaten wird Förderung jetzt doch erwähnt.“ Über die Gründe des Arbeitgebers von Nr. 23 kann indes nur spekuliert werden; offenbar ging es hier um ein Stipendium, das eine Recherche erst möglich machte.
„Ein regelrechter Candystorm“
Von ihrem Publikum erfahren Journalist*innen eher selten eine Reaktion auf einen gewonnenen Preis. Zu der Frage danach antworten von 61 Personen, die hierzu antworteten, 45 mit Nein, keine oder kaum. Aber, immerhin: „Viele Glückwünsche und Kommentare, z. B. auf Facebook“ hat Nr. 25 bekommen, „viele positive Mails“ Nr. 33; ähnlich Nr. 40 und Nr. 60. Deutlich mehr Zuwendung seiner Mitmenschen hat Nr. 37 bekommen, aber das ist wohl eine Ausnahme: „Es gab einen regelrechten Candystorm von Lesern/Usern (E-Mails, Kommentare in den sozialen Medien, Briefe, Anrufe, persönliche Gespräche). Das ist mir in meiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nie passiert. Ansonsten beschweren sich die Leute eher über Artikel, wenn ihnen etwas nicht passt. ,Nichts gesagt ist genug gelobt‘, heißt es sonst bei uns. Jetzt sprechen die Leute einen einfach an und gratulieren – sogar beim Joggen im Wald.“
„Nie mehr arbeiten zu müssen“, diese – augenzwinkernde – Erwartung hat sich für Nr. 17 und alle anderen natürlich nicht erfüllt. Eine bessere Bezahlung durch den Arbeitgeber, eine Belohnung des Wettbewerbserfolgs, hat auch Nr. 18 nicht bekommen. Nr. 1 aber sagt, ihm*ihr sei nach dem Gewinn des OBP „mehr zugetraut“ worden. Nr. 3 konnte den eigenen Status in der Redaktion verbessern. Von 35 Antworten zu dieser Frage lauten aber 18 eher auf Nein. Ausgewogen fällt das Urteil von Nr. 5 aus: Der Brenner-Preis „war für meine Karriere nicht wichtig, weil am Ende die publizistische Leistung insgesamt zählt und nicht Orden. Trotzdem war der Preis für eine journalistische Standortbestimmung sehr wichtig und sehr ermutigend. Insofern hatte er sicher einen wichtigen, aber nicht messbaren Stellenwert.“
Wo und wie kann der Otto Brenner Preis besser werden?
Wir hatten die angefragten Preisträger*innen und Stipendiat*in auch ermutigt, sich kritisch mit dem Otto Brenner Preis an sich und seiner Preisverleihung auseinanderzusetzen. Insgesamt überwog die Wertschätzung, auch hinsichtlich des Festaktes: „Die Veranstaltung habe ich als die beste Preisverleihung in Erinnerung, die ich hatte (von vielen)“, so Nr. 3; ähnlich Nr. 2. Und eine „Laudatio von Prantl“ sei sowieso das Höchste der Gefühle, pointiert Nr. 34. Überhaupt wurde die Kompetenz der Jury anerkannt: „Die Jury erschien mir sehr kompetent“, so Nr. 50, für ihn*sie mit ein Grund für die Bewerbung. Skeptisch schaute Nr. 7 auf das Verfahren zur Vorauswahl: „Die Bewerbungsbeiträge werden häutig von einer Vor-Jury gesichtet. Hier zweifele ich an der Kompetenz. Zum Beispiel werden oft Journalistik-Studierende mit der Vorauswahl betraut. Diese haben schon aufgrund ihres Alters eine Vorliebe für bestimmte Themen und können oft aufgrund der noch geringen Berufserfahrung Rechercheleistungen nicht richtig einschätzen.“
Die Schilderung von Nr. 7 trifft zwar empirisch auf den Otto Brenner Preis zu. Was er*sie aber nicht wissen kann: Die Studierenden entscheiden nicht frei, sondern in Absprache mit der Leitung der Vorauswahl (eine Funktion, die auszuüben ich viele Jahre die Ehre hatte). Mit einem entsprechenden Erfahrungshintergrund kann also ein etwaiger Themen-Bias oder eine Verkennung von Rechercheleistungen korrigiert werden.
„Mehr Anerkennung innovativer Formate“ und „rotierende Jury“
Dennoch: was sollte anders werden beim Otto Brenner Preis? Nr. 1 wünscht sich „mehr Anerkennung innovativer Formate“ und nennt beispielhaft Podcasts, Tiktoks und Instagram-Kanäle. Auch auf diesen „neuen Wegen“ werde „wichtige investigative Arbeit“ geleistet. Nr. 4 fände mehr Diversität bei den Preisträger*innen, aber auch in der Jury gut; ähnlich Nr. 8. Nr. 5 stimmt zu und spricht von „Fluktuation“ im Auswahlgremium. Da säßen „erfahrene, gute Leute, nur tatsächlich alle sehr weiß und nicht gerade jung. Das sollte sich ändern“, meint Nr. 6, schiebt aber ein „großes Dankeschön für die tolle Arbeit“ hinterher.
Nr. 9 stellt sich eine „rotierende Jury“ vor, die öffentlich tagen und argumentieren sollte, damit Preisbegründungen nachvollzogen werden können. Nr. 11 spricht noch mal das liebe Geld an: „Es klingt vielleicht etwas undankbar, aber: Die Preisgelder sollten vielleicht der Inflation angepasst werden. Seit 2020 25 Prozent Teuerung von Flügen, Unterkunft, Bahn etc. heißt auch, 25 Prozent weniger Recherchemöglichkeit für dasselbe Geld.“
Auf einen Grundkonflikt, der auch die Jury während zwei Jahrzehnten immer wieder beschäftigt hat, kommt Nr. 7 in einer sehr grundsätzlichen Wortmeldung zu sprechen: „Preiswürdige Beiträge zu recherchieren und zu schreiben ist für viele Freiberufler*innen aus wirtschaftlichen Gründen oft unmöglich. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund für mich, zwischen fest/frei zu unterscheiden: Häufig stehen hinter preiswürdigen Beiträgen Teams, die natürlich über deutlich größere zeitliche, fachliche und finanzielle Ressourcen verfügen als Einzel-Autor*innen. Diese Teams werden i.d.R. aus festangestellten Redakteur*innen gebildet. Für Freiberufler*innen ist es oft schwierig, Teams zu bilden, weil dann das Honorar durch mehrere geteilt werden muss. Alleine gegen ein Spitzenteam aus einer Redaktion anzutreten, ist meist aussichtslos.“
Das alles ist wahr und umreißt zweifelsohne ein großes Dilemma, das übrigens nicht nur auf den Otto Brenner Preis zutrifft. Bei wohl den meisten Journalismuspreisen scheinen Deutschlands Elite-Redaktionen ein Abonnement auf immer neue Auszeichnungen zu haben. Das Dilemma ist aber nicht leicht aufzulösen – es sei denn, eine Preisstifterin wie die Otto Brenner Stiftung entschiede sich, den Wettbewerb nur noch für freie Journalist*innen und/oder kleine Redaktionen auszuschreiben. Das aber würde einhergehen mit einer qualitativen Verarmung, weil manche Spitzenleistungen nicht mehr vorkommen dürften.
Was eine unabhängige Jury mindestens tun kann: immer wieder und mit geschärfter Aufmerksamkeit auf die Freien und die Kleinen zu achten.
Literaturverweise:
Gerlach, Lena et al. (2024): Onlinepreise und journalistische Innovationen: Befragung zum Grimme Online Award. In: Kretzschmar, Sonja et al. (Hrsg.): Innovationen im Journalismus: Theorien – Methoden – Potenziale? Wiesbaden: Springer VS, S. 81-96.
Pedersen, M.J. & Nielsen, C.V. (2016): „Improving survey rates in online panels: Effects of low-cost incentives and cost-free text appeal interventions“ In: Social Sciences Computer Review, 34 (2), S. 229-243, https://doi.org/10.1177/0894439314563916.