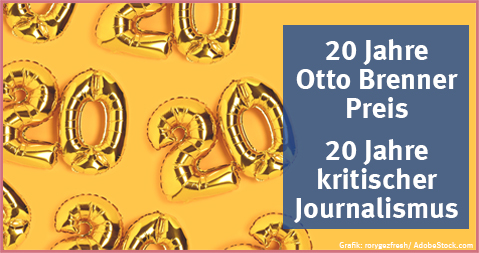Der steinige Weg zur Wahrheit
Das Making-of der preisgekrönten Kabul-Recherche von Christian Schweppe
Ab Frühjahr 2021 wagte sich Christian Schweppe an ein investigatives Vorhaben, welches ihn mitten in das Fiasko des größten Auslandseinsatzes der Bundeswehr führen sollte. Seine Reportage, am 4. Januar 2024 in der ZEIT veröffentlicht, beleuchtet das folgenschwere Versagen des Westens im August 2021, als die islamistischen Taliban die Macht in Kabul zurückeroberten. Schweppes Artikel mit dem drastischen Titel „Wahnsinn. Eine Riesenscheiße“ wurde von der Jury des Otto Brenner Preises mit dem ersten Preis ausgezeichnet.
Von Laura Niedermüller
Der Preisträger Christian Schweppe stammt aus Paderborn und ist – nach Festanstellungen in Redaktionen wie WELT und The Pioneer – inzwischen freier Journalist mit Schwerpunkt auf Verteidigungs- und Außenpolitik. Im Anschluss an sein Journalistikstudium spezialisierte er sich mit einem Master in Investigative Journalism in Schweden. Er recherchierte dann für verschiedenste Medienhäuser zum missglückten Afghanistan-Abzug, zu Korruption in der Krebsmedizin und zum Lobbyismus der Rüstungsindustrie. Die deutsche Sicherheitspolitik beobachtet er bereits seit Jahren, war als Journalist mit der Bundeswehr in Afghanistan, Mali und Niger. Für seine Arbeit wurde er neben dem Otto Brenner Preis mit dem Medienpreis des Deutschen Bundestags und dem Reporter:innen-Preis ausgezeichnet. Schweppe recherchiert und schreibt derzeit unter anderem für DIE ZEIT, das ZDF und den SPIEGEL.
Die Anfänge der Afghanistan-Recherche
Christian Schweppes erste Berührung mit Afghanistan reicht bis ins Jahr 2019 zurück. Damals nahm er an einer vom Verteidigungsministerium organisierten Journalistenreise teil, die ihn nach Afghanistan und Mali führte. Diese Reise bot ihm und anderen die Möglichkeit, das Militärcamp und die Bedingungen in Afghanistan aus erster Hand zu erleben, obwohl die Personen, mit denen die Presse vor Ort sprechen durfte, „häufig vorausgewählt“ wurden, so Schweppe. Seine ersten Erfahrungen in Afghanistan beschreibt der Reporter daher als „eine Mischung aus hilfreich und unbefriedigend“, da der Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse begrenzt gewesen sei. Der Fokus dieser Reise an den Hindukusch lag auf der aktuellen Berichterstattung und Schweppe konnte deshalb noch „nicht in die Tiefe tauchen“. Während seine Kollegen „nonstop und sehr schnell“ über die aktuellen Ereignisse vor Ort berichteten, schrieb Schweppe damals einen ausführlichen Bericht über seine mehrtägige Reise.
„Ich bin 2017 nach Berlin gezogen und habe angefangen, als Reporter und Redakteur im Investigativ-Team der WELT zu arbeiten“, erinnert sich Schweppe. Regelmäßig berichtete er über die Bundeswehr, darunter eine investigative Recherche zur sogenannten Berater-Affäre der ehemaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Inzwischen sind auch die sogenannte Zeitenwende und der Ukrainekrieg ein Thema für Schweppe, aber Afghanistan habe ihn über die Jahre hinweg nie wirklich losgelassen. Als die Taliban im August 2021 Kabul schließlich einnahmen, berichtete er als Investigativjournalist der WELT aus der Ferne über die dramatischen und chaotischen Evakuierungsversuche der Ortskräfte.
Aus diesem Einsatz erwuchs der erste Kontakt mit Ortskräften: Im Sommer 2021 traf Schweppe erstmals auf Einheimische, die jahrelang für die Bundeswehr und den deutschen Staat gearbeitet hatten. Dabei lernte er auch Tamina Ahmadi kennen. Die afghanische Journalistin analysierte für die Bundeswehr die Propaganda der Taliban. Als die Islamisten in Kabul einrückten, endete für die junge Frau von einem Tag auf den anderen das Leben, das sie bisher kannte. Sie musste fliehen. Unterstützung erhielt sie dabei weder von der Bundeswehr noch der Bundesregierung – sie war auf sich allein gestellt. Während ihrer Flucht blieb sie allerdings mit Christian Schweppe in Kontakt und schaffte es schließlich eigenständig nach Deutschland. Schweppe schrieb später ihre Geschichte auf.
Über inoffizielle Kontakte bei der Bundeswehr stellte er Verbindungen zu weiteren Ortskräften her. „Mit denen habe ich mich dann einfach mal getroffen und mir angehört, wie sie nach Deutschland gekommen sind, was ihre Probleme waren und wie die Bundeswehr mit ihnen umgegangen ist. Und das war für mich nochmal total gewinnbringend“, erzählt Schweppe. Oft sind nicht nur die Ortskräfte selbst, sondern auch deren Familien in Afghanistan akut in Gefahr. Im Rechtsverständnis der Taliban ist es Gesetz, dass in dem Fall, dass eine Person, die bestraft werden soll, nicht aufzufinden ist, stattdessen deren Familienmitglieder bestraft werden.
Kabul fällt – und die Lage der Ortkräfte wird bedrohlich
Als die Taliban Kabul übernahmen, war Schweppe nicht mehr vor Ort, doch er hatte die Entwicklungen genau verfolgt. „Es gab schon im Frühsommer und im Frühjahr Berichte im SPIEGEL, auch über die Ortskräfte“, betont Schweppe, „daher kann eigentlich niemand sagen, dass nicht frühzeitig auf deren Lage aufmerksam gemacht worden wäre“. Tatsächlich berichteten zwischen April und Anfang August 2021 zahlreiche Medien über die Situation der Ortskräfte vor Ort und warnten vor dem Szenario, dass die Taliban Kabul erobern würden. Die Ortskräfte selbst machten durch Demonstrationen vor dem Militärcamp auf sich aufmerksam, wie Schweppe berichtet. Doch schon zwei Monate vor der Eroberung Kabuls durch die Taliban war die Bundeswehr nicht mehr im Land. Wegen der Corona-Auflagen musste Christian Schweppe die Geschehnisse aus der Ferne verfolgen. „Journalistisch war das natürlich sehr unbefriedigend, aber auch verständlich, weil man nicht derjenige sein will, der das Coronavirus in ein riesiges Militärcamp einschleppt. Damals gab es ja noch keinen Impfstoff“, erinnert sich Schweppe. „Ich glaube aber bis heute, dass die Tatsache, dass man nicht ins Land kam, auch dazu beigetragen hat, dass nicht alle hier in Deutschland die Situation in Afghanistan auf dem Schirm hatten.“
Dadurch gestaltete sich auch der Kontakt zu Informant*innen schwierig. Durch regelmäßige Telefonate mit vertrauten Ortskräften, die Schweppe bereits während seiner Arbeit vor Ort kennengelernt hatte, blieb er über die Vorgänge in Kabul auf dem Laufenden. Kontakte zu neuen Ortskräften aufzubauen, gestaltete sich hingegen sehr schwierig – vor allem rund um den Machtwechsel in Kabul. Fast zwei Wochen lang berichtete Schweppe in einer Doppelrolle: Zum einen informierte er als Korrespondent über die aktuellen Ereignisse vor Ort und recherchierte gleichzeitig als Investigativ-Reporter die persönliche Fluchtgeschichte der jungen Afghanin Tamina Ahmadi. Schließlich stand er nicht nur vor einer Unmenge von Regierungsdokumenten, sondern blieb auch mit vielen offenen Fragen und Eindrücken zurück. Erst mit seiner nachfolgenden Berichterstattung über Afghanistan konnte er diese schließlich aufarbeiten.
Geheime Regierungsdokumente
Während der Rest der Welt das journalistische Interesse an den Geschehnissen in Afghanistan mit der Zeit verlor, wollte Schweppe das Thema unbedingt weiterverfolgen. Er blieb mit seinen Quellen vor Ort im Gespräch. Anfang 2023 – mittlerweile arbeitete er nicht mehr als Reporter bei der WELT – erhielt Schweppe Zugang zu vertraulichen Regierungsdokumenten: Die Kabul-Akten der Bundesregierung. Abertausende Seiten verschiedener Ministerien und Behörden der letzten Koalition von Angela Merkel. Nachdem er die Echtheit der Dokumente geprüft hatte, begann er alles auszuwerten: Vermerke, Morgenlagen, E-Mails, Protokolle – 220 Gigabyte an Informationen. „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass diese Akten einen Überblick über das Gesamtversagen geben. Diese Daten legten wahnsinnig viele Abgründe, öffentlich relevante Missstände und problematische Vorgänge in den Ministerien offen“, sagt Schweppe. Im Sommer 2023 bot er seine Idee der ZEIT an. Durch seine Arbeit als freier Journalist hatte er bereits Kontakt mit Holger Stark in der Chefredaktion und die Zusammenarbeit kam daraufhin schnell zustande. Im Dezember gab er die erste Version seines Kabul-Textes ab – mit einer Länge von 50.000 Zeichen. Im Januar 2024 folgte die zweite Version und der Artikel war auf die Hälfte der ursprünglichen Textlänge eingedampft: „Ich musste so komprimieren, dass das Wesentliche nicht verloren geht und die wichtigen Dokumenteninhalte dann trotz Kürzen noch drin sind. So kam dann ein Text zustande, der sehr, sehr dicht ist“, erzählt Schweppe.
Mehr als 15 Stunden Faktencheck
Der Schreibprozess war intensiv und verlangte Schweppe viel ab. Unterstützung bekam er von Peter Dausend, ZEIT-Korrespondent für Verteidigungsthemen. „Es ging in unserer Zusammenarbeit eher um die Struktur des Textes. Das war für mich sehr angenehm, weil er nicht seine Schreibe über den Text gegossen hat“, erzählt Schweppe. Quellenarbeit und Faktencheck blieben beim Reporter: Mehr als 15 Stunden am Stück habe er dafür gebraucht, weil in so gut wie jedem Satz oder Halbsatz ein, zwei oder noch mehr Dokumente enthalten waren. „Das war mit Sicherheit die aufwendigste Factchecking-Aufgabe, die ich in meinen mehr als zehn Jahren Berufsleben gemacht habe “, betont Schweppe.
Finanzielle Absicherung vor dem Erfolg
Schweppe bewarb sich im Frühjahr 2023 erfolgreich um ein Recherchestipendium bei Netzwerk Recherche. Es bot ihm die finanzielle Sicherheit, um tiefer in die Kabul-Akten eintauchen zu können und die Zeit zu überbrücken, in der er noch kein Honorar für diese Arbeit bekam. Als freier Investigativreporter trug Schweppe bei Beginn der Recherchen alle finanziellen Risiken des Langzeitprojekts selbst. Dank des Stipendiums waren dann 5.000 Euro von den Recherchekosten abgedeckt. Heute resümiert der Brenner-Preisträger: „Ich war sehr glücklich, dass die ZEIT das Thema dann sofort interessierte und das Echo auch sehr, sehr groß war, als es schließlich gedruckt wurde.“
Christian Schweppes Recherche verdeutlicht, dass tiefgreifende investigative Arbeit nicht nur Ausdauer und Präzision, sondern oft auch persönliches Engagement erfordert. Aufbauend auf seiner jahrelangen thematischen Vorarbeit, der akribischen Auswertung vertraulicher Regierungsakten sowie dem persönlichen Kontakt zu Betroffenen gelang es Schweppe, das vielschichtige Versagen deutscher Politik im Kontext des Afghanistan-Abzugs in seiner ganzen Tragweite offenzulegen. Dabei wird zudem deutlich, wie wichtig unabhängige Recherchestipendien im Journalismus sind, um den notwendigen Freiraum für derartige Recherchen jenseits der tagesaktuellen Berichterstattung zu schaffen.